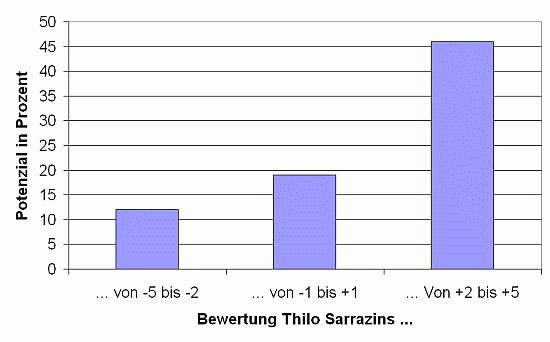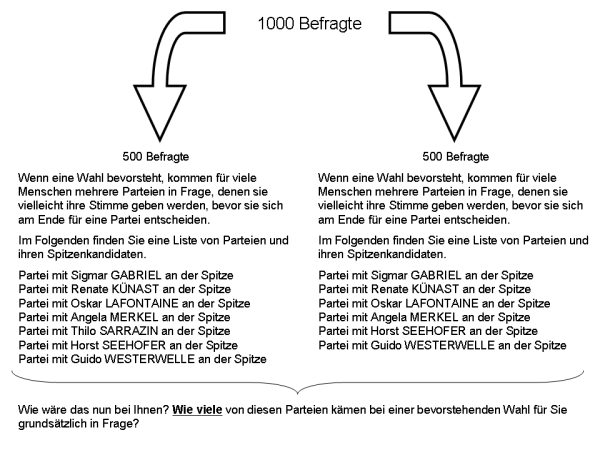Spätestens seit dem Regierungsantritt der Großen Koalition im Jahr 2005 hatte die CDU/CSU ihre bis dato ausländerkritische Haltung zugunsten einer Integrationsoffensive (Integrationsgipfel, Islamkonferenz) zurückgestellt. Die beiden Unionsparteien schienen (endlich) in der Realität der „Einwanderungssituation ohne Einwanderungsland“ (Klaus Bade) angekommen zu sein, die sie mehrheitlich fast eine ganze Generation lang negiert hatten. Als „Anerkennung und Eingliederung anstatt Ignoranz und Ausgrenzung“ könnte man diese Phase der unionsgeführten Migrationspolitik überschreiben. Das vorläufige Ende dieser Phase wurde vom neuen Bundespräsidenten Christian Wulff eingeläutet, indem er bei Amtsantritt nicht nur – wie vor ihm bereits Johannes Rau – erklärte, Präsident aller in Deutschland lebenden Personen zu sein, sondern dadurch, dass er am Tag der Deutschen Einheit darüber hinaus feststellte, dass der Islam inzwischen zu Deutschland gehöre.
Spätestens seit dem Regierungsantritt der Großen Koalition im Jahr 2005 hatte die CDU/CSU ihre bis dato ausländerkritische Haltung zugunsten einer Integrationsoffensive (Integrationsgipfel, Islamkonferenz) zurückgestellt. Die beiden Unionsparteien schienen (endlich) in der Realität der „Einwanderungssituation ohne Einwanderungsland“ (Klaus Bade) angekommen zu sein, die sie mehrheitlich fast eine ganze Generation lang negiert hatten. Als „Anerkennung und Eingliederung anstatt Ignoranz und Ausgrenzung“ könnte man diese Phase der unionsgeführten Migrationspolitik überschreiben. Das vorläufige Ende dieser Phase wurde vom neuen Bundespräsidenten Christian Wulff eingeläutet, indem er bei Amtsantritt nicht nur – wie vor ihm bereits Johannes Rau – erklärte, Präsident aller in Deutschland lebenden Personen zu sein, sondern dadurch, dass er am Tag der Deutschen Einheit darüber hinaus feststellte, dass der Islam inzwischen zu Deutschland gehöre.
Dass diese – in der Beschreibung korrekte – Äußerung nun zu einer Art „Backlash“ in den Reihen der Union, einer reflexartigen Gegenpositionierung hinter eine vor allem von der CDU mühevoll errungene, realitätsnähere Politikposition führt, hat situative, strategische, aber auch im Parteienwettbewerb fest verankerte Gründe. Die situativen Gründe sind offenbar: Die Regierung hatte einen katastrophalen Start, von dem sie sich – für viele Beobachter überraschend -, bislang nicht erholen kann. Mit der Steuer-, Atom- und Gesundheitspolitik macht sich Schwarz-Gelb bislang wenig Freunde, und mit Stuttgart 21 hat sich auch noch eine „baugleiche“ Landesregierung ins Taumeln geprügelt. Selbst Stammwähler von Union und FDP geraten derzeit ins Grübeln darüber, ob sie diese Politik unter Anwendung dieser Mittel noch gutheißen können.
Aus strategischer Sicht spiegelte der Wandel der Union zu einer grundsätzlich zuwanderungsoffenen, in jedem Fall aber integrationsbejahenden Inländer-Partei auch den Wunsch wider, für Deutsche mit Migrationshintergrund, die inzwischen ein erhebliches Wählerpotenzial darstellen, wählbar zu werden. Die wenigen Analysen, die sich 1999-2002 mit dem Wahlverhalten von Migranten in Deutschland beschäftigt haben, kommen zum Schluss, dass die Union zwar unter den Aussiedlern und Spätaussiedlern hohe Stimmenanteile (über 60 Prozent) erhalten hat, dass sie jedoch unter ehemaligen ausländischen Arbeitnehmern und insbesondere unter türkeistämmigen Wählern chancenlos ist (rund 10 Prozent). Während die Zahl der wahlberechtigten Spätaussiedler stagniert, nimmt die Zahl der wahlberechtigten Türkeistämmigen zu. Und neueste Untersuchungen zur Bundestagswahl 2009 (in Vorbereitung) geben Grund zur Annahme, dass die hohe Zustimmung für die CDU/CSU bei Russlanddeutschen deutlich nachlässt, während Gewinne der Union bei den Türkeistämmigen marginal sind. Die Tatsache, dass die leicht veränderte Migrationspolitik an der Wahlurne keine Früchte trägt, ist ein möglicher Grund für die erneute Positionsänderung der Union. Der andere, wahrscheinlich gewichtigere Grund ist der vermeintlich „rechte“ Rand der Bevölkerung, den man zusätzlich zu Teilen der politischen Mitte nicht auch noch verlieren möchte. Die Union fürchtet nicht nur den alten Bahnhof, sondern auch einen deutschen Geert Wilders und vor allem den Verlust von Regierungsmehrheiten bei Landtagswahlen, der auch Auswirkungen auf die Regierungsstabilität im Bund haben würde.
Doch der eigentliche Konflikt, der zunächst in den Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten offenbar wurde, sitzt deutlich tiefer. Den Unionsparteien ist es bislang gelungen, die Vorstellung einer ethnisch-kulturell homogenen Gesellschaft mit ihrem Parteinamen exklusiv und gleichzeitig wählbar zu verbinden. So erstaunt es nicht, dass eine Analyse der Einstellungen der Bundestagskandidatinnen und -kandidaten des Jahres 2005 ergab, dass die Parteizugehörigkeit zur CSU einerseits und zu den Grünen andererseits, Extrempositionen in der Frage des Zuzugs von Einwanderern aus demographischen und ökonomischen Gründen darstellen. Während also Grünen-Politiker aufgrund des Arbeitsmarktes und der demographischen Entwicklung häufig die Notwendigkeit von Zuwanderungsregelungen sehen, sind CSU-Politiker selten dieser Ansicht. Insofern sagt Horst Seehofer nur das, was in seiner Partei gedacht wird. Und auch bei der Frage nach kultureller Anpassung von Einwanderern an die deutsche Gesellschaft nehmen die Kandidatinnen und Kandidaten von CSU und Grünen gegensätzliche Positionen ein, werden allerdings von den Politikern einer jeweils anderen Partei überboten: CDU und Linkspartei. Folglich überrascht es nicht, dass sich große Teile der CDU gegen die Vorstellung aussprechen, kulturelle Differenz sei Teil des christlichen Abendlandes (und müsste folglich mehr oder minder akzeptiert werden). Aus der wertfreien Perspektive eines Parteienwettbewerbs, der unterschiedliche Politikangebote machen sollte, ist gegen solch klare Positionen überhaupt nichts einzuwenden – im Gegenteil: Die Bürger wollen wissen, wofür und wogegen die Parteien stehen.
Langfristig betrachtet handeln CDU und CSU im wahrsten Sinne konservierend: Sie sind Wächter und Anbieter der gesellschaftlichen Vorstellung einer deutschen Nicht-Einwanderungsgesellschaft. Damit können sie den Großteil ihrer Stammwähler wahrscheinlich halten, sofern diese ihnen der Exkurs auf den Integrationsgipfel nicht nachtragen. Doch zu welchem Preis? Die mittel- und langfristigen Kosten eines solchen ethnisch-kulturellen Reflexes sind hoch, denn die Gesellschaft ist längst nicht mehr monokulturell oder gar monoethnisch (sie war es auch nie). Und für viele Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund wird es schwierig bleiben, einer Partei mit einem im Kern monoethnischen Gesellschaftsbild die Stimme zu geben. Für Muslime wird es nochmals schwieriger, denn es handelt sich auch noch um explizit christliche Parteien.
Die vielleicht interessantesten Reaktionen auf diese neuerliche Migrationsdebatte kommen von der FDP. Der Generalsekretär distanziert sich heute in der FAZ von ethnisch-religiösen Argumentationslinien und fordert „Eine republikanische Offensive“. Dazu gehöre sowohl eine Entkoppelung christlicher Konfessionen vom Staat (u.a. mit Blick auf die Kirchensteuer) als auch die Wahrnehmung kultureller Vielfalt als Freiheitsgewinn. Und Wirtschaftsminister Brüderle legt nach, indem er das bereits intensiv diskutierte, aber nicht eingeführte Punktesystem für (Arbeits)Migration wiederbelebt. Ein wenig hat es den Anschein, als versuche die FDP, sich in einem Politikfeld zu profilieren, in dem ihre Politiker bislang Mittelpositionen einnahmen und folglich kaum wahrgenommen wurden. Fakt ist aber auch, dass die FDP bei Integrationsfragen in der Regierung Kohl wiederholt kleinbei gab und damit ihre eigenen Ausländerbeauftragten beschädigte. Ein wenig sieht es schließlich aus, als wollten sich die Regierungsparteien gezielt unterschiedlich positionieren, um verschiedene Wählerklientele besser ansprechen zu können. Mitentscheidend wird dabei sein, wie authentisch sie dies tun werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Migrationspolitik im Sinne einer Konzeptualisierung von diesen vermeintlich politischen Manövern profitieren wird.
Literatur:
Wüst, Andreas M.: Das Wahlverhalten eingebürgerter Personen in Deutschland, Aus Politik und Zeitgeschichte B52/2003, S. 29-38.
Wüst, Andreas M.: Bundestagskandidaten und Einwanderungspolitik: Eine Analyse zentraler Policy-Aspekte, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 19 (1), 2009, S. 77-105.
 „Eigentlich hab‘ ich ja nichts gegen Ausländer, aber…“ In Wien ist dieser Satz nicht selten zu hören. Dann werden die klassischen Argumente aufgezählt, obwohl keine empirische Evidenz für sie spricht: „Die nehmen unsere Arbeitsplätze weg“, „die fressen unsere Renten auf“, „die sind kriminell“, „jetzt dürfen sie auch noch in den Gemeindebauten wohnen, die wir von unseren Steuern bezahlen“…
„Eigentlich hab‘ ich ja nichts gegen Ausländer, aber…“ In Wien ist dieser Satz nicht selten zu hören. Dann werden die klassischen Argumente aufgezählt, obwohl keine empirische Evidenz für sie spricht: „Die nehmen unsere Arbeitsplätze weg“, „die fressen unsere Renten auf“, „die sind kriminell“, „jetzt dürfen sie auch noch in den Gemeindebauten wohnen, die wir von unseren Steuern bezahlen“…