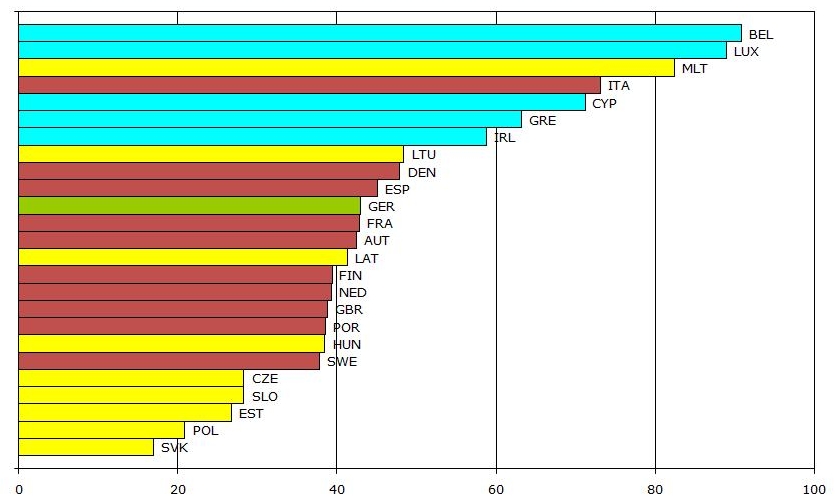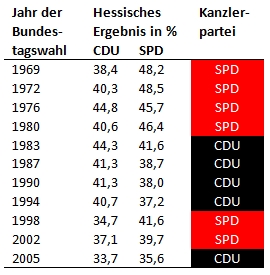Wahlsystemfragen gelingt es nur selten, über einen eng umgrenzten Spezialistenzirkel hinaus öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Die Überhangmandatsklausel bildet dazu keine Ausnahme. Vermutlich hat mancher Beobachter sogar den Eindruck gewonnen, sie diene vor allem dazu, Institutionen der politischen Bildung eine Legitimationsgrundlage zu schaffen und Examenskandidaten verschiedener Studienfächer in Verlegenheit zu bringen. Im Juli 2008 jedoch bündelte diese Regelung das Interesse der Öffentlichkeit. Denn das Bundesverfassungsgericht verwarf das gültige Bundestagswahlsystem wegen des mit den Überhangmandaten zusammenhängenden Problems des so genannten „negativen Stimmgewichts“. Allerdings forderte es nicht eine umgehende Änderung des Wahlsystems, sondern gab dem Gesetzgeber dafür bis Ende 2011 Zeit. Diese Entscheidung begründete es vor allem mit der Komplexität der zu regelnden Materie.
Wahlsystemfragen gelingt es nur selten, über einen eng umgrenzten Spezialistenzirkel hinaus öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Die Überhangmandatsklausel bildet dazu keine Ausnahme. Vermutlich hat mancher Beobachter sogar den Eindruck gewonnen, sie diene vor allem dazu, Institutionen der politischen Bildung eine Legitimationsgrundlage zu schaffen und Examenskandidaten verschiedener Studienfächer in Verlegenheit zu bringen. Im Juli 2008 jedoch bündelte diese Regelung das Interesse der Öffentlichkeit. Denn das Bundesverfassungsgericht verwarf das gültige Bundestagswahlsystem wegen des mit den Überhangmandaten zusammenhängenden Problems des so genannten „negativen Stimmgewichts“. Allerdings forderte es nicht eine umgehende Änderung des Wahlsystems, sondern gab dem Gesetzgeber dafür bis Ende 2011 Zeit. Diese Entscheidung begründete es vor allem mit der Komplexität der zu regelnden Materie.
Diese Entscheidung dürfte den Verfassungsrichtern umso leichter gefallen sein, als Überhangmandate bisher die Machtverteilung zwischen parlamentarischer Mehrheit und Minderheit, also die zentrale Machtfrage in der parlamentarischen Demokratie, im Kern unberührt ließen. Aus der Tatsache, dass bislang noch keine Regierung ihre Mehrheit Überhangmandaten zu verdanken hatte, folgt freilich nicht, dass dies im Jahr 2009 ebenfalls so sein wird. Die Zukunft ist nicht notwendigerweise eine Fortschreibung der Vergangenheit. Dies gilt nicht nur für Aktien, die nach jahrzehntelang aufsteigender Tendenz binnen kurzer Zeit dramatisch an Wert verlieren, sondern auch in der Politik können sich die Verhältnisse grundlegend verändern.
Nimmt man – bei aller methodenbedingter Vorsicht – etwa momentane Umfrageergebnisse zum Maßstab, erscheint es beispielsweise nicht ausgeschlossen, dass bei der Bundestagswahl 2009 Union und FDP zwar auf der Grundlage ihrer Zweitstimmenergebnisse keine parlamentarische Mehrheit erhalten, aber Überhangmandate für die Union eine christlich-liberale Mehrheit im Bundestag ermöglichen. Die neue Bundesregierung könnte somit ihre parlamentarische Mehrheit einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Regel verdanken. Es ist eine offene Frage, ob eine solche Regierung – getreu dem in verschiedenen parteipolitischen Konstellationen bewährten Grundsatz „Mehrheit ist Mehrheit“ – gebildet würde, wie es um ihr Ansehen und ihre Durchsetzungsfähigkeit bestellt wäre und ob auf juristischem Wege gegen sie vorgegangen würde. In jedem Fall hat das Bundesverfassungsgericht eine politisch delikate Konstellation geschaffen, die Anlass für manche Diskussion bieten dürfte.