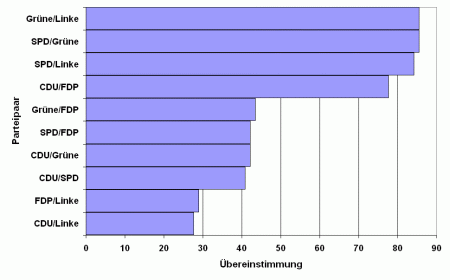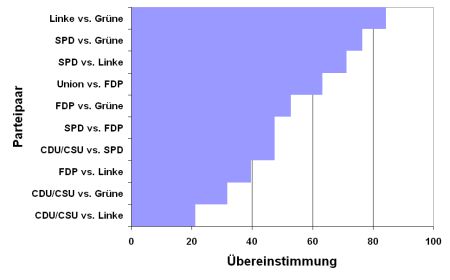Am 9. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Die Wahl ist die Grundlage für die spätere Bildung der Regionalregierung in dem bevölkerungsstärksten Bundesland Deutschlands. Aber gibt es in Deutschland überhaupt so etwas wie „Regionalwahlen“? Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist wichtig. Vielleicht ist sie wichtig für die Bildungspolitik in NRW. Studiengebühren, das Schulsystem – und (nicht ganz unabhängig von Bildung) – auch die unbelehrbaren Raucher in den Kneipen zwischen Bielefeld und Bonn könnten vom Ergebnis betroffen sein.
Trotz aller Föderalismusreformen bleibt die Landtagswahl in NRW aber in erster Linie eine Wahl zur Bundespolitik. Sie ist es schon unabhängig vom Ergebnis: Nie war es so deutlich wie jetzt (obwohl auch frühere Regierungen derselben Logik gefolgt sind): Reformen auf Bundesebene, die vielen schaden und wenigen nützen, macht man nach Landtagswahlen – und nicht davor. Aber wie wird sich die Wahl inhaltlich auswirken? Nun, es könnte sein, dass sich nichts verändert. Wenn die „christlich-liberale“ Regierung auch in NRW bestätigt würde, dann wären Jürgen Rüttgers und Andreas Pinkwart gestärkt. Die Bundeskanzlerin und ihr Außenminister hätten dann für die Zukunft jeweils einen wichtigen internen Rivalen behalten.
Die Alternative ist jede andere Koalitionsregierung in NRW. Sollte eine der Oppositionsparteien – egal welche – an der Landesregierung beteiligt werden, dann sind die Gewinner: Bündnis 90/Die Grünen. Das gilt selbst für den (unwahrscheinlichen) Fall einer rot-roten Landesregierung, selbst dann, wenn die Grünen den Einzug in den Landtag verpassen würden. Wieso das? Bisher verfügen schwarz-gelbe Landesregierungen insgesamt über eine theoretische knappe Mehrheit im Bundesrat. Die Mehrheit ist theoretisch, weil die Kammer der Landesregierungen selten ausschließlich nach parteipolitischen Vorgaben entscheidet. Aber bisher reicht es eben, wenn Merkel und Westerwelle ihre Leute hinter sich bringen. Dann – und nur dann – können sie jedes Gesetz und jede Verordnung verabschieden, solange das Grundgesetz unberührt bleibt.
Dies kann sich nach der „Landtagswahl“ in NRW ändern. Die Anführungsstriche sollen verdeutlichen: Hier handelt es sich um eine Wahl, deren Bedeutung für den Bund wichtig ist. Nicht nur, weil sie ein Signal sendet, und eine Rückmeldung gibt, für die bisherige Arbeit der Regierung.
Die wichtigste Bedeutung der Landtagswahl in NRW liegt darin, dass sie die schwarz-gelben Landesregierungen um ihre Mehrheit im Bundesrat bringen kann. Um eines klar zu stellen: Das heißt nicht, dass „die Opposition“ dann eine Mehrheit im Bundesrat hätte, auch nach der NRW-Wahl werden unionsgeführte Regierungen eine Mehrheit im Bundesrat stellen. Diese Mehrheit braucht die Opposition aber auch nicht. Koalitionen auf Landesebene pflegen zu vereinbaren, dass sie sich bei Unstimmigkeiten im Bundesrat der Stimme enthalten. Da Enthaltungen (auch nach dem gescheiterten Vorstoß von Wolfgang Schäuble, dies zu ändern) bei der Gesetzgebung des Bundes weiterhin wie Nein-Stimmen zählen, fehlt jedem Regierungsentwurf für ein zustimmungspflichtiges Gesetz die Mehrheit im Bundesrat. Konkret heißt das: Nicht nur knapp die Hälfte aller Gesetzesvorhaben der Bundesregierung drohen zu scheitern, sondern es sind vor allem die zentralen Reformen, die eine Zustimmung durch die Länderkammer benötigen.
Was würde das politisch bedeuten? Die Bundesregierung bräuchte die Zustimmung von Landesregierungen, an denen mindestens eine Oppositionspartei beteiligt ist. Und dabei würde die Zustimmung der Länder Hamburg und Saarland reichen – in beiden Ländern sind die Grünen an den Landesregierungen beteiligt. Inhaltlich heißt das: Die schwarz-gelbe Bundesregierung würde in wichtigen Fragen zu „Jamaika“ mutieren. Die Alternative wäre es, mit der SPD zu verhandeln – hier wäre der Preis gegenwärtig wohl noch höher.
Die Grünen werden also plötzlich in der Lage sein, einen Preis zu verlangen, um schwarz-gelb entscheidungsfähig zu halten. Wie wird dieser Preis aussehen? Er könnte generelle Forderungen enthalten, etwa das Festhalten am Zeitplan für den Atomausstieg. Die Grünen könnten auch „billige“ Forderungen stellen, etwa in der Gleichstellungspolitik. Dies wäre „billig“, weil wesentliche grüne Positionen längst von führenden Vertreterinnen der Bundesregierung geteilt werden.
Wahrscheinlicher sind aber Tauschvereinbarungen, die jedes einzelne Politikfeld betreffen. Denn auch wenn im Bundesrat Parteienvertreter sitzen und man dann die Grünen braucht: Einen neuen förmlichen Koalitionsvertrag wird es nicht geben. Jedes einzelne Gesetz muss so gestrickt sein, dass die Grünen in Hamburg und im Saarland zustimmen können. Das heißt etwa in der Gesundheitspolitik: Es wird Forderungen nach einer Stärkung von Qualitätssicherung und (nichtmedizinischer) Prävention geben – und diese werden auch erfüllt werden. In der Verkehrspolitik werden sich die Grünen für ein Nachhaltigkeitskonzept einsetzen, das nicht allein technische Lösungen sondern auch Verhaltenssteuerungen beinhaltet.
Insgesamt wird sich nicht nur der Inhalt der Bundespolitik ändern. Die neuen Machtverhältnisse werden alle Beteiligten auf die Probe stellen: Sind die Grünen bereit für Jamaika? Wird sich ein Bündnis mit den Grünen in der CDU durchsetzen lassen? Wie wird die Kanzlerin mit den zu erwartenden Widerständen aus FDP und CSU umgehen? Die Landtagswahl in NRW ist somit spannend. Sie wird nicht nur die Machtverhältnisse auf Bundesebene nachhaltig mitbestimmen, sondern auch die Weichen für die zukünftige Entwicklung unseres Parteiensystems stellen.
 Die Zahlen der Umfrageinstitute sehen Hannelore Kraft auf den letzten Metern im Wahlkampf knapp vorne: Im direkten Vergleich mit Rüttgers schneidet sie laut aktuellem Politbarometer mit 43% zu 41% besser ab als der Ministerpräsident, der somit seinen Amtsbonus vollständig eingebüßt zu haben scheint. Dies ist beachtlich, im Nachgang des Fernsehduells aber nicht wirklich verwunderlich. Wie wir aus empirischen Arbeiten wissen (siehe auch den Beitrag von Thorsten Faas in diesem Blog), dienen Fernsehduelle gerade in Landtagswahlkämpfen dazu, den Bekanntheitsgrad des Herausforderers zu steigern. Seit Mitte März konnte Hannelore Kraft folgerichtig 12 Prozentpunkte zulegen.
Die Zahlen der Umfrageinstitute sehen Hannelore Kraft auf den letzten Metern im Wahlkampf knapp vorne: Im direkten Vergleich mit Rüttgers schneidet sie laut aktuellem Politbarometer mit 43% zu 41% besser ab als der Ministerpräsident, der somit seinen Amtsbonus vollständig eingebüßt zu haben scheint. Dies ist beachtlich, im Nachgang des Fernsehduells aber nicht wirklich verwunderlich. Wie wir aus empirischen Arbeiten wissen (siehe auch den Beitrag von Thorsten Faas in diesem Blog), dienen Fernsehduelle gerade in Landtagswahlkämpfen dazu, den Bekanntheitsgrad des Herausforderers zu steigern. Seit Mitte März konnte Hannelore Kraft folgerichtig 12 Prozentpunkte zulegen.