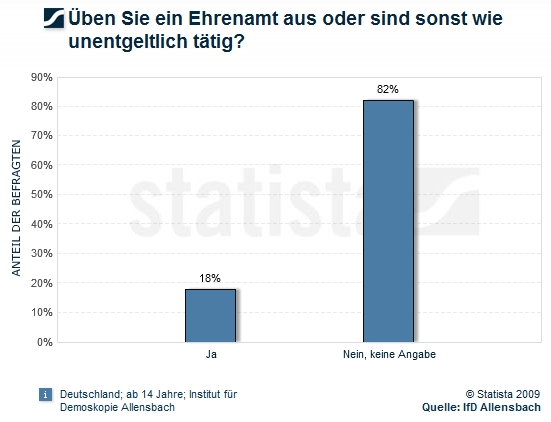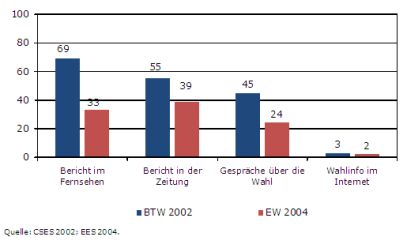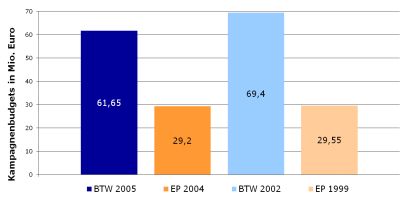Ein Gastbeitrag von Michael Metzger
Das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl wurde als erstes per Twitter bekannt. Während die zwitschernde CDU-Politikerin sich reuig zeigte, verteidigt ihr SPD-Kollege seine öffentliche 140-Zeichen Botschaft als demokratischen Akt.
Es war 14.13 Uhr am Samstag, als Ulrich Kelber es im Reichtstagsgebäude nicht mehr aushielt. Der Bonner Bundestagsabgeordnete zückte sein Mobiltelefon und tippte: „Auszählung dauert lange. Gerücht: Köhler hat 613 Stimmen. Das wäre genau die kleinste Mehrheit“. Wenige Sekunden später tickerte das Statement über Kelbers Twitter-Seite. Damit war ein Wahlergebnis in der Welt, das offiziell noch nicht verkündet worden war.
Ulrich Kelber war schnell. Nicht viel langsamer aber waren sein Parteifreund Garrelt Duin, der SPD-Chef aus Niedersachsen, und Julia Klöckner von der CDU. Duin schrieb nur eine knappe Minute später als Kelber: „613 für Köhler. #bpw“. Und Klöckner fast zeitgleich: „#Bundesversammlung Leute, Ihr könnt in Ruhe Fußball gucken. Wahlgang hat geklappt!“.
Nicht alle freute das Gezwitscher. Schließlich verkündete Bundestagspräsident Norbert Lammert das Ergebnis offiziell erst um 14.30 Uhr, eine gute Viertelstunde später. Die Christdemokratin Klöckner entschuldigte sich inzwischen. In ihrer Partei hatten sich manche bei der „Twitter-Sünderin“ (BILD) beschwert. Sie habe ihr Amt als Wahlfrau für Publicity missbraucht.
Gleichwohl: Die Trittwer-Gemeinschaft war stolz auf den neuen Coup. Erneut ein Ereignis, das zuerst durch das Mikroblog publik wurde. Wie in den USA beim Unfall des Airbus über dem Hudson-River oder in Deutschland beim Schul-Attentat in Winnenden. Unter dem Tag „#BPW“, freuten sich diesmal die Nutzer, bei der „Bundespräsidentenwahl“ schneller informiert zu sein als die TV-Zuschauer.
Twitter ist aber auch risikobehaftet. Redaktionelle Medien prüfen und filtern Informationen meist. Bei Twitter fällt das weg. Was passiert, wird mitgeteilt – ohne Zeitverlust. Für den Wahrheitsgehalt trägt deshalb zwar allein der Schreiber die Verantwortung, sagt Klas Roggenkamp, Geschäftsführer von Compuccino, einer Berliner Medienberatungsagentur. „Aber auch der Leser steht in der Pflicht, zu prüfen, woher er seine Informationen hat.“ Informationen bei Twitter sind subjektiv, geprägt von der Sicht des Senders – und eben nicht immer wahr. Wie der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel feststellen musste, der im Landtagswahlkampf bald mindestens einen Twitter-Imitator hatte.
Wenn Informationen dank Twitter schneller und freier verfügbar sind, sei das dennoch wünschenswert, sagt Roggenkamp. Informationen, die früher auf den Fluren von Bundestag und Bundesrat kursierten, finden nun in Windeseile ihren Weg ins Netz. Die ganze Welt hört so den politischen Flurfunk.
Aber es wird auch viel banaler Stuss gezwitschert, nicht zuletzt von Politikern. So schreibt Frederic Schneider von der CDU Hessen: „käuft sich am Donnerstag das #Objektiv #Canon EF 70-200mm, f/4 L USM :)“. Oliver Fink von der FDP Schleswig-Holstein schreibt: „Wie jetzt? Lieber 0 Grad und strömender Regen?!? Kommt wieder, musst nur warten…“ Und Gabriele Hiller-Ohm von der SPD Schleswig-Holstein teilt mit: „ist nach dem Nautischen Abend nicht mehr ins Büro gefahren um den Schreibtisch leerzufegen, was sich morgen rächen wird.“
Ulrich Kelber, der SPD-Abgeordnete mit dem schnellen Twitter-Daumen am Köhler-Tag, hält davon wenig. Niemals würde er die Farbe seiner Socken der Welt mitteilen, sagt er im Gespräch zu ZEIT ONLINE. Lieber beschränke er sich auf Politik.
Mit Twitter könne man Menschen in kleinen Häppchen die große Politik schmackhaft machen, sie für Themen begeistern und die eigene persönliche Einschätzung gleich mit transportieren, sagt Kelber. „Im Reichstagsgebäude wussten die anwesenden Wahlhelfer und Journalisten schon vor meiner Nachricht, wie die Wahl ausgegangen ist. Warum soll ich das meinen Twitter-Lesern dann vorenthalten?“, fragt er rhetorisch.
Doch ständiges Geschnatter nervt auch Kelber. Auf Parteisitzungen stören ihn die „Leute, die einen Zwischenstand aus einer laufenden Debatte in ihr Handy tippen – statt sich mal selber an der Diskussion zu beteiligen“. So etwas mache Diskussionen kaputt. Der Politik nehme es die Verschnaufpause, die gebraucht wird, um Gedanken zu Ende zu denken.
Aber am Samstag sei es schließlich nicht um Diskussionskultur gegangen, sondern vor allem um die von vielen bemängelte Einhaltung des protokollarischen Rahmens im Reichtstag: Die Gratulationen an Horst Köhler wurden zu früh ausgesprochen, das Orchester positionierte sich, ehe Bundestagspräsident Norbert Lammert die Ergebnisse offiziell verkündet hatte. Ein Fauxpass!, alles via Twitter dokumentiert.
Etwa von Julia Klöckner um 14.36 Uhr: „#Bundesversammlung Protokollarisch ging eben einiges schief – Blumen, Kapelle kamen rein vor Ergebnisbekanntgabe“. Nach der Rede des alten wie neuen Staatsoberhaupts konnte sie sich aber dennoch freuen: „Bundes-Hotte hält Dankes/Antrittsrede – toll!!!!“
Update: Julia Klöckner hat sich inzwischen nicht nur entschuldigt sondern auch auf ihr Amt als Schriftführerin im Parlament verzichtet.
 Mehr als eine halbe Million Mal ist bis heute der Wahl-O-Mat zur Europawahl gespielt worden. Damit sieht es so aus, dass bis zu den Wahlen in knapp zwei Wochen diese Wahl-O-Mat-Version die Zahl der Nutzungen des Tools vor der letzten Europawahl 2004, die bei rund 870.000 lag, toppen wird.
Mehr als eine halbe Million Mal ist bis heute der Wahl-O-Mat zur Europawahl gespielt worden. Damit sieht es so aus, dass bis zu den Wahlen in knapp zwei Wochen diese Wahl-O-Mat-Version die Zahl der Nutzungen des Tools vor der letzten Europawahl 2004, die bei rund 870.000 lag, toppen wird.