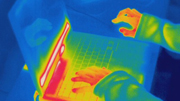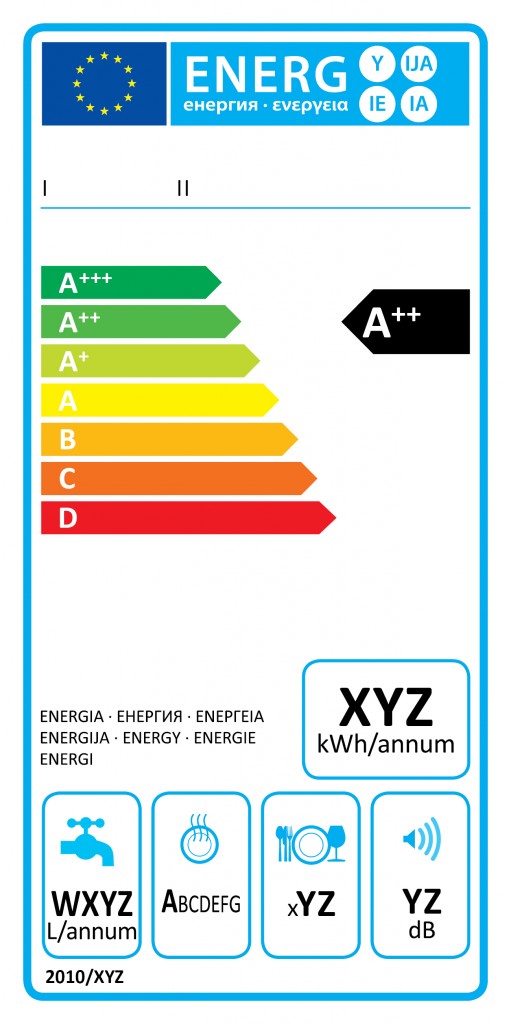Der WWF hat ein neues Siegel für Fische aus Unterwasserfarmen entwickelt, das Aquaculture Stewardship Council (ASC). Es soll nachhaltige Fischzucht auszeichnen. Bereits jetzt gibt es das Marine Stewardship Council (MSC), das auf vielen Fischverpackungen im Supermarkt klebt. Es gilt jedoch nur für Meeresfisch. Die Supermärkte drängen auf das zweite Zeichen, denn die einst als blaue Revolution gepriesene Aquakultur ist in Verruf geraten.
Umweltschützer monieren allerdings, das Zeichen des WWF tauge wenig. Statt eherner Vorgaben gebe es wachsweiche Empfehlungen, damit möglichst viel Zuchtfisch als nachhaltig geadelt werden könne.
Zugleich steht fest, dass sich der Verbraucher sich klare und einfache Siegel an Produkten wünscht, um eine gute Entscheidung fällen zu können. Und Fisch steht inzwischen häufig auf dem Speiseplan. Das geben die Meere aber nicht her. Egal wie viel Kabeljau, Lachs oder Shrimps gefangen wird, es ist zu wenig, um den wachsenden Appetit zu stillen. Der Verzehr ist mit rund 17 Kilogramm pro Kopf so hoch wie nie zuvor, wie aus dem aktuellen Weltfischereibericht hervorgeht. Fast die Hälfte davon kommt bereits aus Fischzucht. Aquakulturen müssen zunehmend den Bedarf decken, da die Fischbestände nach Jahrzehnten der Überfischung in einem beklagenswerten Zustand sind.
Zuletzt nahm die Produktionsmenge jährlich um rund sieben Prozent zu. Die Versprechung der Aquakultur ist verlockend: Statt Fische zu fangen, könne man sie züchten und ihre Artgenossen im Meer in Ruhe lassen. Das zweifeln Naturschützer aber bereits seit langem an. Aquakultur sei keine Lösung, sondern eher ein Grund für die Überfischung. Für die Mast der Fische braucht man Futter. Und das werde aus Wildfisch hergestellt. Für ein Kilo Lachs werden bis zu fünf Kilo wild gefangener Fisch verfüttert. Weitere Kritik: Typisch sei die Zerstörung küstennaher Lebensräume wie Mangrovenwälder etwa für Shrimpszuchten, das Fangen von wildem Jungfisch, um die Farmen aufzufüllen oder der Eintrag von Chemikalien und Antibiotika aus den Käfigen, Bassins und Netzen ins Meer.
„Aquakultur ist nur dann eine Alternative zu Wildfisch, wenn sie umweltfreundlich betrieben wird“, bestätigt WWF-Fischereiexpertin Heike Vesper. Deshalb habe der WWF das neue Zeichen speziell für Zuchtfisch angeschoben. Unterstützt wird der ASC von Handelskonzernen wie Metro oder Edeka. ASC-Fische sollen demnächst in jedem namhaften Supermarkt zu finden sein.
Inzwischen liegen die ersten Standards für Pangasius und Tilapia vor, zwei der mengenmäßig bedeutsamsten Zuchtfische. In Deutschland zählt der billige, weiße Pangasius zu den Top Fünf der beliebtesten Speisefische. Die Regeln für Lachs, Shrimps und Forelle folgen Mitte des Jahres. Parallel wird ein Logo entwickelt.
Aber wie hoch ist die Messlatte, die der ASC an sein Zeichen anlegt? Vom WWF als starker Stimme im Naturschutz erwarten die Verbraucher zu Recht viel. An der Güte der WWF-Wimpels entzündet sich aber momentan Streit.
Naturland, die ein eigenes Bio-Siegel für Aquakultur verwenden, bemängeln, dass die Umweltstandards zu niedrig seien und wichtige Fragen wie die Besatzdichte, also die Intensität des Farmens, nicht geregelt seien. „Wenn zu viele Fische auf zu dichtem Raum gehalten und gemästet werden, ähnelt das der Käfighaltung von Hühnern“, sagt Naturland-Fischexperte Stefan Bergleiter. Dafür sollte es kein Prädikat geben. Allzu lax geregelt sei auch, was gefüttert werde und mit welchen Medikamenten die Fische behandelt werden dürften. All das wird bei den Ökozuchten von Naturland definitiv schärfer gehandhabt.
Auch Greenpeace lässt kein gutes Haar an der WWF-Plakette. Das Siegel werde analog zum MSC schon im Planungsprozess vergeben, obwohl die Fischerei noch gar nicht nachhaltig sei. „Das ist so, als würde jemand schon als schlank bezeichnet, obwohl er noch 25 Kilo Übergewicht hat“, kritisiert Thilo Maack von Greenpeace. Vorschusslorbeeren seien in einem derart veritablen Wirtschaftszweig, wo es um sehr viel Geld gehe, keine gute Idee.
WWF-Fischexpertin Heike Vesper bestreitet, dass das Siegel vergeben wird, bevor alle Umweltauflagen umgesetzt seien. Und auch Besatzdichten seien festgelegt. Sie gesteht allerdings zu, dass für den ASC Kompromisse gemacht worden seien. Und natürlich sei Bio immer besser. Aber davon sei einfach zu wenig da.
Der Handel diskutiert zur Zeit, ob man nicht selber nachlegen solle und Nachbesserungen fordern als sich für einen wachsweichen Standard prügeln zu lassen. Auf die Händler, die Umweltstandards für Fisch nach oben nachjustieren wollten, wartet der WWF nach eigenen Angaben gerne.