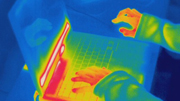Nur neun der 200 größten deutschen Unternehmen zeigen wirklich gute Leistungen in puncto Klimaschutz. Das ist das ernüchternde Ergebnis des heute veröffentlichten Deutschlandberichtes 2010 des „Carbon Disclosure Projects“ (CDP).
Obwohl die gemeinnützige Organisation bereits zum fünften Mal Klimadaten von Unternehmen erhebt, ließen sich nur 122 von 200 Firmen in die Karten schauen. Zu den Verweigerern zählten die Heidelberger Druckmaschinen, Jungheinrich, Hugo Boss, Villeroy&Boch oder Pro Sieben/Sat 1. Allerdings machten mehr mit als im vergangenen Jahr. Damals gaben nur 102 Firmen Auskunft über ihre Treibhausgasemissionen.
CDP-Geschäftsführer Caspar von Blomberg, der auch die Bundesregierung in Klimafragen berät, zeigte sich vor allem von der Bestenliste, dem „Carbon Performance Leadership Index“ (CPLI) enttäuscht. Der CPLI nimmt nur Unternehmen auf, die vollmundigen Bekenntnissen auch Taten folgen lassen. In „Klasse A“ und damit aufs Siegertreppchen schafften es nur neun Unternehmen. Auf den ersten Plätzen liegen BASF, Bayer, BMW und die Deutsche Post, gefolgt von Deutscher Telekom, E.ON, Munich Re und Siemens und TUI. „Ich hätte gedacht, dass wir weiter sind“, sagt von Blomberg trocken.
Zumal es noch mehr schlechte Nachrichten gibt. Betrachtet man den reinen Ausstoß von Treibhausgasen, so sinken die Emissionen zwar um 6,5 Prozent. Doch Ursache für das Minus ist vor allem die Rezession. Die Unternehmen haben schlicht weniger produziert und verkauft. Rechnet man also ehrlicher die Emissionen pro Umsatz aus, so ergibt sich ein anderes Bild. Zwei Drittel der Unternehmen haben nämlich selbst gebeutelt von der Krise mehr ausgepustet als zuvor. Offenbar gebe es zwar viele „Lippenbekenntnisse“ pro Klimaschutz , so Blomberg, aber in der Realität würden die Firmen eben doch auf die Bremse treten.
Mehr noch: Die Investitionen der Firmen in den Klimaschutz haben sich von 2008 auf 2009 halbiert und liegen bei mageren 27 Milliarden Euro. Da ein ehrgeiziges internationales Klimaschutzabkommen fehle, warteten die Unternehmen erst mal ab, erklärt von Blomberg. Dabei seien viele Titanen wie Siemens, BMW oder auch die Deutsche Post durchaus für den Fall gerüstet, dass strengere Gesetze kommen.
Das CDP erstellt seine Umfrage im Auftrag von 534 institutionellen Investoren, die zusammen mehr als 64 Billionen US-Dollar verwalten und somit einen bedeutsamen Anteil des an weltweiten Märkten zirkulierenden Kapitals repräsentieren. Diese Finanziers nutzen die CPD-Daten, um ihre Investitionen abzusichern. Wer den Klimawandel im Auge habe, so das Kalkül, sei für die Zukunft gut gewappnet und stelle deshalb eine rentablere Anlage dar.
Womöglich überlegen sich internationale Kapitalgeber angesichts der zwergenhaften Leistungen der deutschen Wirtschaft künftig zweimal, ob sie Geld in solche Unternehmen stecken oder sie gar meiden. Zumindest würden sie „konkretere Einsparerfolge bei den Emissionen“ verlangen. So könnte der Kapitalmarkt den Druck in Richtung Klimaschutz noch erhöhen, sagt von Blomberg.
Hier der Report zur Ansicht: cdp_report 2010 (3)