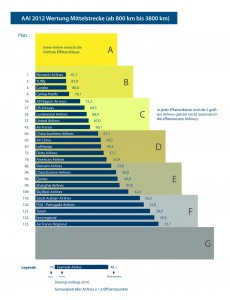Seit Jahren führt China die Rangliste der weltweit größten Kohlendioxid-Emittenten an. Gleichzeitig will das Land den Ausstoß reduzieren: Bis 2020 sollen die CO2-Emissionen um 40 bis 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 sinken. Der 12. Fünfjahresplan, den der Volkskongress im vergangenen Jahr verabschiedet hat, sieht die Einführung eines Emissionshandels vor. Die Idee dahinter ist simpel: Wer CO2 emittiert, muss dafür ein Verschmutzungsrecht vorweisen. Hat er keines, muss er eines kaufen. Hat er zu viele, kann er sie verkaufen. So entsteht ein Markt für Kohlendioxid, der sich regulieren lässt.

Bleibt die Frage: Wie organisiert China das bloß? So langsam wird das konkreter. Inzwischen ist klar, dass China ein CO2-Handelssystem in sieben Piloregionen testen will. Dazu gehören Shanghai, Peking, Tianjin, Shenzhen, Chongqing, Guangdong und Hubei.
Mitte August startete etwa das Projekt in Shanghai. Wie das Portal China Law and Practice berichtet, sollen hier in einem ersten Schritt die Emissionen von rund 200 Firmen aus 16 verschiedenen Industrien erfasst werden. Unter anderem wird sich Baosteel, einer der weltweit größten Stahlkonzerne und damit ein großer Stromverbraucher (und zwangläufig auch CO2-Emittent) künftig einem solchen Schema unterwerfen müssen und mit Co2-Zertifikaten handeln. Wie schon in Europa werden die Behörden die erste Runde von Verschmutzungsrechten kostenlos verteilen.
In China einen Emissionshandel aufzubauen, ist natürlich extrem kompliziert. Allein das Datensammeln wird zur Herausforderung: Welche Industrieanlage emittiert eigentlich genau wie viel CO2? Außerdem sind die Energiemärkte alles andere als liberalisiert. Das geht schwer mit dem Preissignal-Ansatz eines Emissionshandels zusammen.
Die Bepreisung von Kohlendioxidemissionen verteuert die Produktion einer Kilowattstunde in einem Kohlekraftwerk. In Europa würde ein Stromversorger diese Kosten einfach auf den Endkundenpreis umlegen.
Das ist aber in China mit seinen regulierten Großhandelsmärkten und subventionierten Strompreisen kaum möglich. Laut der chinesischen Presseagentur Xhinhua kostete im Sommer in Peking eine Kilowattstunde Strom 0,48 Yuan. Das macht umgerechnet gerade einmal fünf Cent. Daran wird die Politik wohl kaum etwas ändern wollen.
„Das System in China wird erst einmal wenig ehrgeizig sein“, sagt Felix Matthes, Energieexperte des Öko-Instituts, der zurzeit chinesische Firmen bei der Einführung des Systems berät. Matthes hält das allerdings für nicht überraschend: Es ginge schließlich darum, die Unternehmen erst einmal überhaupt von dem System zu überzeugen – und nicht mit zu strengen Anforderungen zu erschrecken und gar für Komplettwiderstand zu sorgen. Das sei ähnlich bei der Einführung des europäischen Emissionshandelssystems gewesen.
Das ist natürlich Realpolitik pur. Aber wahrscheinlich der Erfolg versprechendere Weg.