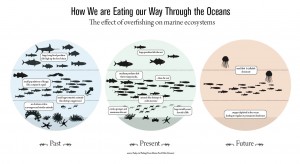Vor kurzem hat die Arbeitsgruppe Umwelt des EU-Parlaments eine interessante Studie zum Thema „Umweltschädigende Subventionen“ veröffentlicht: „EU subsidies for polluting and unsustainable practices„. Eine deutsche Zusammenfassung gibt es auf den Seiten des Ecologic Institutes aus Berlin. Untersucht wurden die EU-Ausgaben in den Bereichen Landwirtschaft, Strukturpolitik, Verkehr und Energie sowie Fischerei.
Auch wenn der Tonfall zurückhaltend ist, inhaltlich ist die Bilanz verheerend (das hat man auch geahnt). Damit die EU ihre selbst gesteckten Ziele der 2020-Strategie erreicht und einen nachhaltigen, sprich: klima-und umweltfreundlichen, Haushalt vorlegt, muss sie noch „viel tun.“
Spannend sind etwa die Haushaltsposten im Bereich Verkehr und Energie. Was Umweltschützer immer wieder kritisieren, wird in der Studie mit Zahlen unterlegt: Europa hat viel übrig für Atomenergie, wenig für Erneuerbare Energien. Der Haushaltsplan der EU sieht für das Jahr 2011 im Bereich Energie Ausgaben von insgesamt 2,9 Milliarden Euro vor (u.a. für Forschungsprojekte oder lokale Initiativen). Diese teilen sich wie folgt auf:
„Fusionsenergie hat einen Anteil von 14 Prozent, Forschung im Bereich Energie unter verschiedenen Titeln einen Anteil von 12 Prozent Kernenergie unter verschiedenen Titeln einen Anteil von 12 Prozent und konventionelle und erneuerbare Energien kommen auf 4 Prozent.“
Die Ausgaben für eindeutig nachhaltige Energieformen (u.a. für Solar und Wind) machen also nur einen geringen Anteil des Haushaltsposten aus. Gerade die Milliarden für den Fusionsreaktor sind absurd, da klar ist, dass er vor 2050 kaum realisiert werden kann – für den Klimaschutz ist er also erst einmal keine große Hilfe. Die Empfehlungen der Autoren sind eindeutig:
„Investments on environmentally friendly-agriculture, energy and resource efficiency, renewable energies, sustainable mobility, eco-friendly technologies, etc. could improve competitiveness and increase employment in sectors that are considered to be crucial in the short, mid and long term.“
Leider konkretisieren die Autoren nicht, wie viele Arbeitsplätze sich durch eine „grünere“ EU-Haushaltspolitik schaffen ließen (nun gut, das war auch nicht ihre Aufgabe). Aber klar ist: Die EU wird ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht.