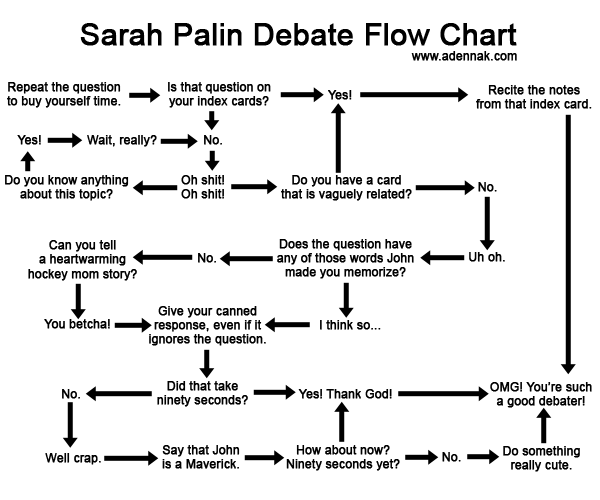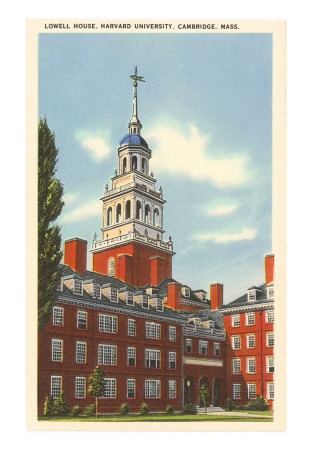Cambridge, Mass. – Biden gibt den Charmeur: „It’s a pleasure to meet you, Governor, and to be with you…“ Dann kommt er gleich auf Obama und dessen Haltung zum Bailout zu sprechen. „Wir werden uns auf die Mittelschicht konzentrieren“, und das unterscheidet uns von unseren Konkurrenten, so Biden.
Palin spricht sofort die Ängste in der Bevölkerung an. Sie wendet sich direkt ans Volk und erwähnt die Konkurrenz überhaupt nicht. Sie schaut Biden nicht an. Sie wirkt sehr selbstsicher. (21:07h)
Biden erinnert an McCains Satz, die Grundlage der Wirtschaft sei stark . Die Frage war allerdings, wie die beiden Kandidaten die Polarisierung Washingtons überwinden wollen. Beide machen keine Anstalten zu Versöhnlichkeit. (21:11h)
Palin kritisiert die Mentalität derjenigen, die sich mit dem Hauskauf übernommen haben. Sie appeliert an die konservative Vernunft, nicht über die eigenen Verhältnisse zu leben. Klarer Punkt für Palin. Biden antwortet mit einer Attacke auf McCain, dessen witschaftspolitische Kompetenz er immer wieder in Abrede stellt. Das zieht nicht so gut, weil er keine eigene Position formuliert. (21:15h)
Biden ist wieder – und viel zu lange – damit beschäftigt, seinen Herrn und Meister zu verteidigen. Palin hingegen spricht, als wäre sie selbst die Spitzenkandidatin. Und das ist sie ja auch. Biden wirkt dagegen, als hätte man ihn geschickt, eines anderen Sache zu vertreten. Wieder Punkt Palin, die völlig ruhig wirkt. (21:17h)
Biden macht endlich Punkte, als er über die Mittelschicht und ihre Sorgen spricht. Die Mittelschicht muss endlich entlastet werden. Die Reichen, sagt er, zahlen nicht mehr Steuern als unter Ronald Reagan. Endlich hat er sein Thema gefunden und spricht selbst direkt zum Wähler. (21:19h)
Palin leiert die alte Lehre der Republikaner herunter, dass der Staat nur aus dem Weg gehen muss, damit die Wirtschaft endlich Arbeitsplätze schaffen kann. Damit ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen. (21:21h)
Biden kontert, er wolle nicht Umverteilung, sondern Fairness für die Mittelschicht. Dann verliert er sich in den Einzelheiten der Gesundheitspolitik. Am Ende schließt er mit seiner vorbereiteten Pointe ab: „Das nenne ich die ultimative ‚Brücke ins Nichts‘.“ Sein Refrain ist: keine weiteren Steuererleichterungen für Reiche! (21:24h)
Palin hat ein professionelles, gleichmäßiges Lächeln auf, allerdings von der stählernen Sorte. Dennoch: Sie scheint sich wohlzufühlen. Sie legt eine kleine Selbstlob-Orgie ein, was sie alles für die „Menschen in Alaska“ getan habe. Das tut man eigentlich nicht, bringt auch keine Punkte. Und dann wieder die populistischen Sprüche gegendie „Gier an der Wall Street“. Chuzpe von der Partei, die lange die schützende Hand über Wall Street gehalten hat! (21:26h)
Biden hat keinen Stoff mehr: Jetzt erwähnt er zum dritten Mal den angeblich von McCain beabsichtigten 4 Milliarden-Steuervorteil für Exxon. Langsam muss er eine andere Platte auflegen. Palin ernennt McCain zum einsamen Warner vor der Finanzkrise. Glaubt ihr aber niemand, dass McCain davon umgetrieben gewesen sei. (21:29h)
Palin kommt wieder auf ihre eigene Verdienste in Alaska zurück. Sie stolpert minutenlang herum – dann findet sie den Faden. Sie sagt den Leuten im wesentlichen: Energieunabhängigkeit kriegen wir auch mit Öl hin. In Alaska haben wir noch viel davon. (21:3h)
Palin wieselt herum, als es um den menschlichen Anteil an globaler Erwärmung geht: Sie wolle jetzt nicht in die Ursachenforschung gehen.
Biden kontert, der Klimawandel sei menschengemacht, und es sei wichtig, die Ursache zu kennen, damit man mit vernünftigen Lösungen kommen könne. Er will neue Jobs schaffen durch die erneuerbaren Energien.
Palin verweist wieder auf die Milliarden Barrel Öl in Alaska. Die Demokraten verhindern durch ihre Ablehnung des Bohrens vor der Küste die Lösung der amerikanischen Energieprobleme. (21:38h)
Jetzt gehts zu den kulturkämpferischen Themen: Biden setzt sich für die Rechte von Homosexuellen ein.
Palin erwähnt die traditionelle Familie, betont dann aber, sie sei „tolerant“ und habe nichts gegen Besuchsrechte im Krankenhaus und Gleichbehandlung bei Versicherungspolicen.
Biden will auch keine neue Definition der Ehe. Sie soll nicht für Homosexuelle geöffnet werden. Allerdings soll es eine zivilrechtliche Gleichstellung geben.
Und das ist doch schon mal eine Meldung: Der Kulturkampf ist vorbei. Es gibt zwischen Links und Rechts keinen Streit mehr um die Rechte von Lesben und Schwulen. (21:41h)
Palin verteidigt den „Surge“ und behauptet, Amerika sei auf dem Weg zum Sieg im Irak. Wenn nur die bösen Demokraten nicht gegen die Unterstützung der Truppen gestimmt hätten. Gähn!
Biden greift endlich an und sagt den Satz: Wir werden den Krieg im Irak beenden. „Das ist der fundamentale Unterschied zwischen uns.“ Palin versucht zurückzuschießen: „Ihr Plan ist eine weiße Fahne!“ Sie wirkt nicht sicher dabei. Es ist auch lächerlich, wenn die Alaska-Gouverneurin sich hier gegen Biden erhebt, der sich seit Jahren mit dem Krieg beschäftigt (und selber ursprünglich dafür war). Kein Punkt. Schwach. (21:46h)
Biden hat eine sehr starke Strecke, als er auf den wahren Kampfplatz im Krieg gegen den Terrorismus verweist: Afghanistan und die pakistanische Grenze zu dem Land. Das ist die schwache Seite McCains und Palins: Sie müssen behaupten, der Irak sei die zentrale Front. Und sie wissen, dass das nicht stimmt. Klarer Punkt Biden. (21:51h)
Palin plappert McCains Kritik an Obamas vermeintlicher Iran-Position nach: er wolle sich mit Ahmadinedschad an einen Tisch setzen. Sie wirkt auf diesem Feld nicht zuhause und sehr unfrei. Auch zu Israel leiert sie brav die Positionen herunter: Zweistaatenlösung, kein neuer Holocaust etc. Aber da gibt es keinen Kontrast zur Gegenseite.
Biden greift an: Die Nahostpolitik der Bush-Regierung ist ein einziges Versagen. Hamas und Hisbollah als Gewinnler der „Demokratisierung des Nahen Ostens“.
Palin kann nur antworten, sie sei so froh, „daß wir beide Israel lieben“. Sie sagt ganz generell und unspezifisch, es habe unter Bush „massive Fehler gegeben“, und nun werde der „Wandel“ kommen. Biden kontert sehr gut, er habe noch nicht gehört, wie sich McCains Positionen von Bush unterscheiden. Er läßt sich das „Change“-Logo nich stehlen. (21:57h)
In Afghanistan will Palin die Politik des Surge anwenden. Biden hat die New York Times gelesen, in der heute der leitende General gesagt hat, die Übertragung aus dem Irak sei nicht möglich. Palin fällt zunehmend in sich zusammen. Sie hat hier einfach nichts entgegenzusetzen.
Jetzt versucht sie es doch und behauptet, der General habe das nicht gesagt. Und es werde eben doch gehen. Wie ein trotziges Kind. (22:00h)
Biden wird damit konfrontiert, dass er für die Interventionen in Bosnien war. Er steht dazu, die Intervention sei ein Erfolg gewesen und habe Leben gerettet.
Palin schaltet um auf niedlich: „Es ist so offensichtlich, daß ich ein Washington-Außenseiter bin.“ Süß. Während du, Biden, suggeriert sie, immer wieder hin und her geschwankt bist zwischen Falke und Taube. Funktioniert nicht: „Außenseiter“ übersetzt sich hier einfach als ahnungsloses Greenhorn. (22:07h)
Palin möchte, man sieht es, dass es endlich vorbei ist (ausser wenn man vielleicht noch ein bißchen über Wasilla und den großen Staat Alaska reden könnte).
Biden wird gefragt, was er tun würde, wenn der Präsident stürbe: Er nutzt das sehr geschickt, um Obamas Programm noch einmal aufzusagen – Mittelschicht fördern, Afghanistan gewinnen, Amerika wieder mit der Welt versöhnen. Souverän.
Palin weiss nicht so recht, was sie sagen sagen soll. Sie wird McCains Weg fortsetzen, dann baut sie irgendwie Wasilla ein. Die Regierung soll den Leuten einfach aus dem Weg gehen, sagt sie. Ob das funktioniert, wenn die Menschen sich Schutz und Regulierung wünschen? Habe da meine Zweifel. (22:12h)
Palin flüchtet in die Familiengeschichte. Gleich wird sie ihre alte Tante zuhause am Bildschirm grüßen. Sie spricht über die Wichtigkeit von Erziehung, aber das bleibt – wie alles in der zweiten Hälfte – sehr kursorisch. McCain, enthüllt sie, habe ihr Energie-Unabhängigkeit als Feld in der Regierung versprochen.
Biden wird kein spezifisches Feld haben, sondern er sieht sich eher als Berater. Und dann zischt er plötzlich einen scharfen Angriff gegen Cheney als „gefährlichsten Vizepräsidenten unserer Geschichte“ hervor. Er will den Vizepräsidenten wieder auf seine bescheidenen verfassungsmässigen Funktionen zurückführen.
Palin kommt zum vierten Mal mit ihrer Alaska-Efahrung, die sie qualifiziere, in der Energiepolitik eine führende Rolle zu spielen. Und dann sagt sie, sie verstehe die vielen Menschen, die sich keine Gesundheitvorsorge leisten können. (Will sie ihnen etwa eine Versicherung geben?)
Biden punktet abermals mit einem Plädoyer für einen Wechsel. Die Leute haben genug, sie wollen „Change“. Palin wirft Phrasen um sich vom „Maverick“ McCain, der den wahren Wechsel verkörpere.
Biden greift nun frontal an und sagt, McCain sei eben kein Querkopf gewesen, er habe im wesentlichen immer mit Bush abgestimmt. (22:26h)
Palin bringt zum xten Mal ihre Erfahrung in Alaska im Spiel. Bisschen zu oft.
Biden hat sich für den Schluß eine Geschichte zurechtgelegt, in der er sich bescheiden gegenüber Jesse Helms verneigt, eine der kontroversen rechten Figuren. ein
Palin bezieht sich auf Ronald Reagans Freiheitsideale und leiert etwas herunter über die Mittelschicht, Verteidigung, und die Freude, ein Amerikaner zu sein. Alles sehr kursorisch.
Biden malt ein schwarzes Bild der letzten acht Jahre, bevor er dann die gleichen amerikanischen Werte und Tugenden beschwört wie seine Kontrahentin. Sie müßten allerdings, suggeriert er, erst wieder ins Recht gesetzt werden von Obama und seiner Wenigkeit.
Sarah Palin wirkt sehr erleichtert, geradezu aufgekratzt, als sie Biden für die Debatte dankt. (21:33h)
Sie ist nicht zusammengebrochen unter dem unwahrsacheinlichen Druck, der sich – vor allem durch ihre grauenhaften Interviews – aufgebaut hatte. Sie hat mit Anstand überlebt. Und mit ihr wird noch zu rechnen sein. Niemand hat erwartet, dass sie bei der Aussenpolitik gewinnt. Es war genug, dass sie Biden die ersten zwanzig Minuten lang scheuchen konnte – in der Innenpolitik. Biden hat insgesamt gewonnen, kein Zweifel. Aber Diese Debatte wurde darum überall mit Spannung erwartet, weil man sehen wollte, ob Sarah Palin untergeht. Sie wußte das und hat erfolgreich dagegen angekämpft. Insofern war das ein Erfolg, obwohl Senator Biden gewonnen hat. Sarah Palins Geschichte ist noch nicht zuende. (23:21h)