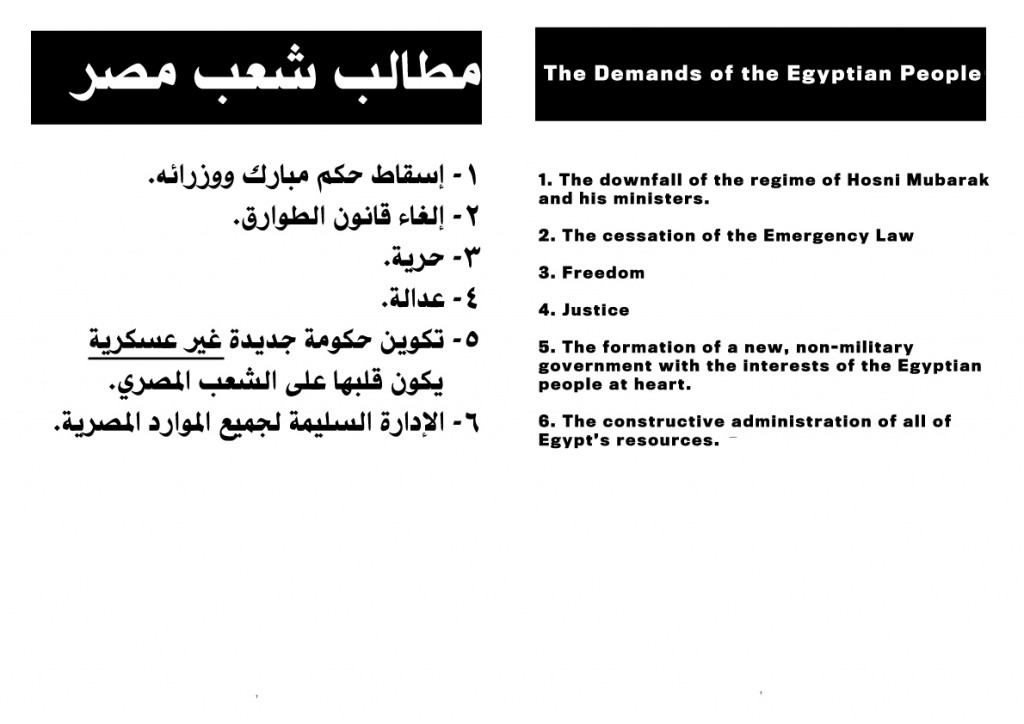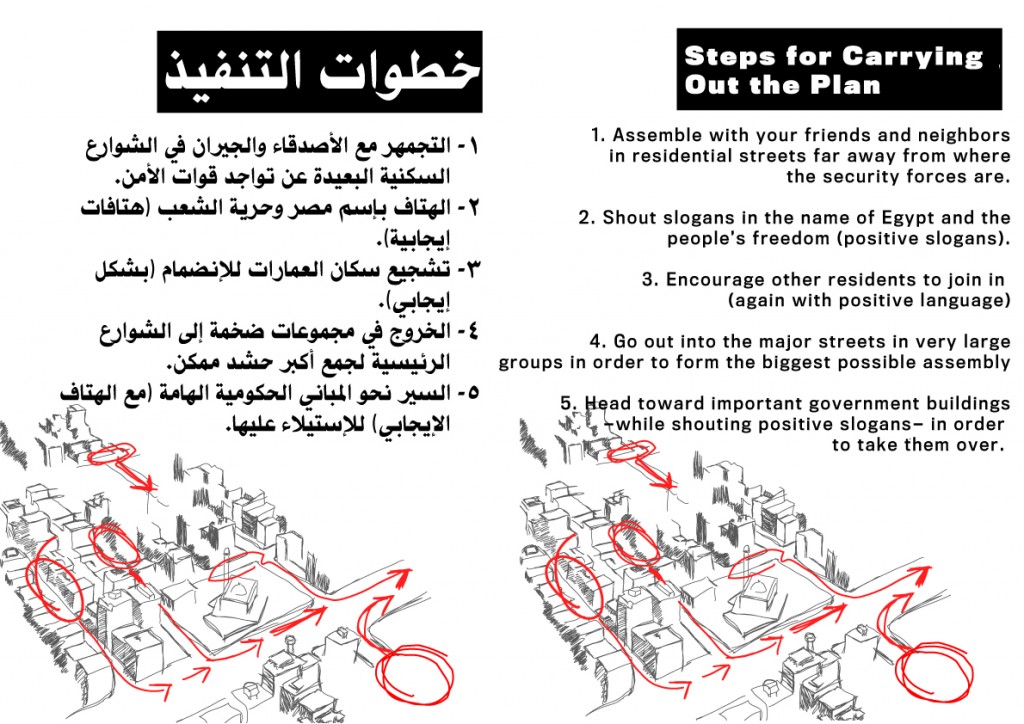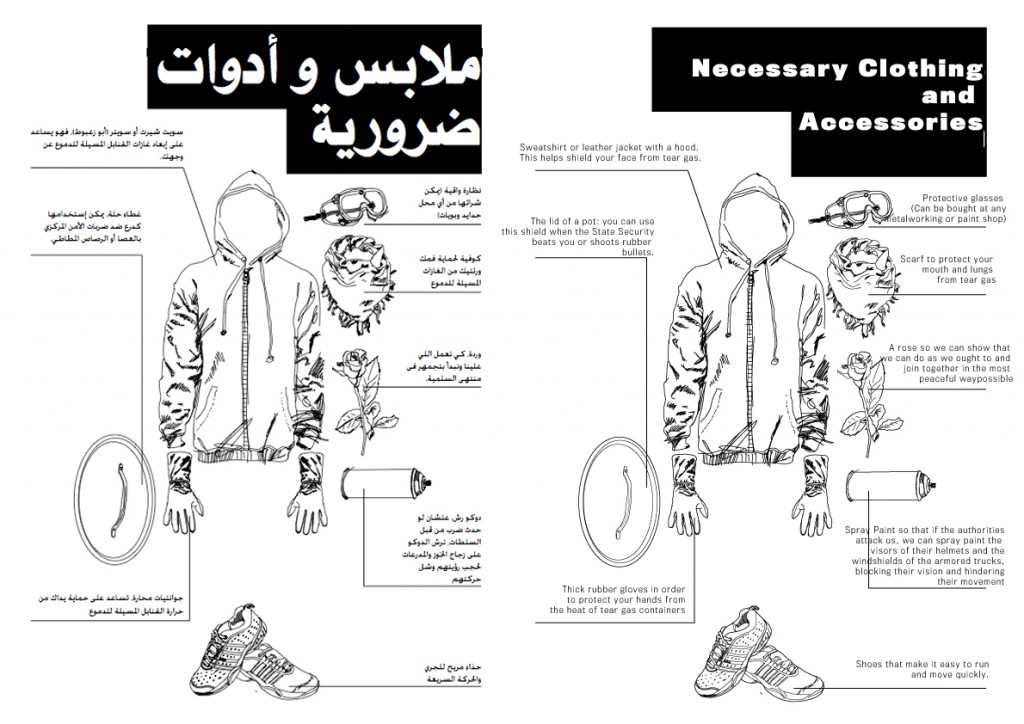Meine Reportage erscheint morgen auf Seite 3 der ZEIT (aus Anlass des Gedenktages zur Befreiung des KZ Auschwitz):
Amsterdam/Malmö/Budapest
Vor einiger Zeit hat Raphael Evers aufgehört, die Tram in seiner Heimatstadt Amsterdam zu benutzen. Auch auf den Markt geht er nicht mehr. Er ist ein sichtbarer Jude – ein Rabbiner mit Rauschebart, breitkrempigem Hut und einem schwarzen Anzug mit Frackschößen, der mittags in Sal Meijers Kosher Sandwichshop ein Broodje Meijer mit gepökeltem Rindfleisch und Senf isst und sich dabei die Sorgen älterer Gemeindemitglieder anhört. Das Lokal im Amsterdamer Süden ist ein sicherer Ort. Die Straßen sind es nicht mehr. »Ich werde beschimpft, manchmal sogar angespuckt. Für Juden wie mich gibt es No-go-Areas in dieser Stadt. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen.«
Das »jüdisch-christliche Erbe« wird in Europa derzeit gern beschworen, um sich vom Islam abzugrenzen. Doch der Vereinnahmung der Juden zur Verteidigung des Abendlands widerspricht das prekäre Lebensgefühl vieler, die ihr Judentum offen leben. Zwar gibt es durch die Einwanderung aus dem Osten eine neue Blüte; erstmals nach dem Holocaust. Doch wer wissen will, wie es heute um das jüdische Leben in Europa steht, der stößt auf Beklommenheit, Verunsicherung und Angst – das zeigt sich auf einer Reise nach Amsterdam, Malmö und Budapest.
»Bewusste Juden«, so wurde am 5. Dezember der liberale Politiker Frits Bolkestein in der Zeitung De Pers zitiert, »müssen sich darüber klar werden, dass sie in den Niederlanden keine Zukunft haben.« Sie sollten mit ihren Kindern lieber nach Israel oder in die USA emigrieren. Der 77-jährige Bolkestein war Vorsitzender der regierenden liberalen Partei VVD und später EU-Kommissar. Bolkestein habe, so Evers, seine Landsleute warnen wollen. Aber die Grünen, die sonst gerne über Rassismus reden, kritisierten den Überbringer der schlechten Nachricht. Ihre Spitzenkandidatin Femke Halsema erklärte, Bolkestein müsse wohl den Verstand verloren haben. Für Rabbiner Evers sind solche Reaktionen Teil des Problems.
Er ist als Direktor des Rabbinerseminars das Gesicht des Judentums im Lande. Er ist ein lebensfroher Typ. Er will kein Opfer sein, und er muss seiner Gemeinde Zuversicht vermitteln. Leicht ist das nicht. Das Klima sei »nicht gut« für »offen lebende Juden«, sagt er: »Aber wir dürfen nicht fliehen. Damit würden wir ja den Antisemiten recht geben! Sprechen Sie mit meinem Sohn, der kann Ihnen mehr erzählen.«
Benzion Evers ist wie sein Vater in der Gemeinde tätig. Aber nicht mehr lange: »In einem Jahr bin ich weg. Ich beende noch mein Studium, dann gehe ich mit meiner Frau nach Israel. Mein Vater sagt das zwar nicht öffentlich, aber ich glaube, nach seiner Pensionierung geht er auch weg.« Der 22-jährige Benzion hat sich schon in der Pubertät darauf eingerichtet, dass man in der Stadt besser keine Kippa, sondern eine Baseballkappe trägt. Er hat gelernt, den arabischstämmigen Schülern, die ihn und seine jüdischen Freunde als »Kanker Joden« (Krebsjuden) mobben, aus dem Weg zu gehen. Und er hat sich damit abgefunden, dass er sich permanent für Israels Politik rechtfertigen muss: »Man kann so leben. Aber es nimmt einem die Luft zum Atmen, wenn man seine Religion und seine Identität verstecken muss. Unseren Kindern wollen wir das nicht zumuten.« Benzion betont, er fliehe nicht nach Israel. Fünf seiner neun Geschwister sind schon in Israel. »Vielleicht macht der Antisemitismus nur den kleineren Teil meiner Entscheidung aus«, sagt Benzion. »Aber als Holländer finde ich, in unserem Land sollte so etwas überhaupt keine Rolle spielen.«
Seine Großmutter, Bloeme Evers-Emden, geboren 1926, ist eine Auschwitz-Überlebende. Sie war auf dem gleichen Transport wie Anne Frank. Sie kam zurück und lebte als Zeitzeugin in Amsterdam. Heute unterstützt sie seine Entscheidung. Eine Million Besucher kamen letztes Jahr ins Anne Frank Haus und ließen sich vom Schicksal dieser Ikone des Leides unter den Nazis bewegen. Wozu dient die Vergangenheitsbewältigung, wenn zugleich die Familien von Überlebenden aus dem Land gegrault werden?
Wer Frits Bolkestein in seinem Büro mit Amstel-Blick aufsucht, findet einen weißhaarigen Herrn vor, der einen sehr klaren, wenn auch bedrückten Eindruck macht. »Wenn Orthodoxe hier in Amsterdam eine Bar-Mizwa feiern, brauchen sie Wachleute. Die jüdischen Gemeinden müssen bei uns für ihre Sicherheit selbst bezahlen, die Regierung und die Stadtverwaltung schauen weg. Und die Politik hat Angst, das Problem anzugehen.«
Der muslimische Antisemitismus ist ein unangenehmes Thema in den Einwanderungsgesellschaften Europas, deren politisches System von Rechtspopulisten bedroht wird. Geert Wilders hat gleich versucht, aus Bolkesteins Äußerungen Profit zu schlagen: Nicht die Juden, sondern die Marokkaner müssten gehen. Die Parteien der Mitte scheuen sich, das Thema aufzugreifen, weil es Wilders nutzen könnte.
Seit Jahren findet eine schleichende Verrohung des öffentlichen Raums statt: Weil Ajax Amsterdam als »jüdischer Club« gilt (im Vorstand und auch im Team gab es gelegentlich Juden), rufen die Fans des Konkurrenten Feyenoord Rotterdam von den Stadionrängen »Hamas, Hamas, Juden ins Gas!«. Erst seit sich ein paar Holocaust-Überlebende darüber in Briefen an die Vereine beschwert haben, beginnt die Liga einzuschreiten.
Seit dem Gazakrieg nimmt der Antisemitismus zu. 2009 – im letzten erfassten Zeitraum – wurde eine Steigerung der judenfeindlichen Straftaten um 48 Prozent registriert. Im Januar 2009, während des israelischen Krieges gegen die Hamas in Gaza, wurden 98 Taten gezählt, neun gewalttätig. Anfang Januar 2011 wurden mitten in Amsterdam Werbeplakate für ein Anne-Frank-Theaterstück mit dem Wort »PaleSStina« überschmiert.
Trotz der Vergangenheit kommen immer mehr junge Israelis nach Europa – ausgerechnet Berlin ist in den letzten Jahren zum Lieblingsreiseziel aufgestiegen. Gleichzeitig entdecken junge Europäer ihr Judentum wieder. Aber viele Juden, besonders orthodoxe, leben wie Rabbiner Evers – vorsichtig, innerhalb selbst gezogener Grenzen. Es gibt einen antisemitischen Alltag, einen offenbar akzeptierten Normalpegel des Hasses – auch in Deutschland: Jahr für Jahr werden im Schnitt 50 jüdische Friedhöfe geschändet, statistisch also jede Woche einer. Es sind meist Juden, die sich um den Antisemitismus kümmern müssen. Auch darum hat sich eine Bedrücktheit über das jüdische Leben gelegt.
Die Frage, wie tolerant Europa ist – wie der Alte Kontinent mit religiöser Vielfalt umgeht –, ist zuletzt anhand von Kopftüchern, Minaretten und Burkas diskutiert worden. Die Offenheit für Muslime ist zu Recht zum Maßstab geworden für das multireligiöse Europa. Darüber droht aus dem Blick zu geraten, wie sich alte Vorurteile, eine neue Demografie und der ewige Nahostkonflikt zu einer giftigen Mischung verquirlen, die Juden das Leben schwer macht. Das multireligiöse Europa muss zeigen, dass die Lehren aus dem Holocaust für alle gelten, auch für die Einwanderer und ihre Kinder.
Eine treibende Kraft der letzten Welle antisemitischer Taten sind muslimische Jugendliche, die selber unter der Engherzigkeit der europäischen Gesellschaften leiden, wenn sie Symbole ihres Glaubens tragen. Zwar wäre es falsch, nur auf sie zu schauen: Ungarn hat nahezu keine Muslime und doch ein wachsendes Problem mit Judenhass. Hier hat nämlich – wie in Teilen Ostdeutschlands – der Rechtsradikalismus Wurzeln geschlagen und sich unter Ministerpräsident Viktor Orbán als normaler Teil des politischen Lebens etabliert. Das neue Phänomen des muslimischen Antisemitismus jedoch ist ein besonders heikles Thema für die Einwanderungsgesellschaften West- und Nordeuropas. Die Hassbekundungen einer kleinen Teilgruppe meist junger, männlicher Migranten muslimischer Herkunft gegenüber Juden gefährden den Religionsfrieden in einem zunehmend multireligiösen Europa.
Auch in Malmö stößt man auf das Wort Gaza, wenn man nach Erklärungen für die Ereignisse der vergangenen Jahre sucht. Aber was hat Fred Kahn, der Vorsitzende der kleinen Gemeinde von Südschweden mit ihren 800 Juden, mit dem Stück Land zu tun, in dem die Hamas regiert? Der freundliche Herr mit Glatze und Schnurrbart, ein pensionierter Professor für Biochemie und Mikrobiologie, ist Schwede durch und durch. Früher, sagt Kahn, war Judenhass ein Phänomen der südschwedischen Neonazi-Szene. Heute machten vor allem Jugendliche aus dem islamisch geprägten Einwanderermilieu Probleme. Fast ein Fünftel der Bevölkerung Malmös ist muslimisch. Fred Kahn betont mehrfach, dass »99 Prozent der Muslime absolut friedlich« seien. Es gebe exzellente Verbindungen zu islamischen Gemeinden. Der Zentralrat der Juden, betont er, habe sich seit Jahren gegen die in Schweden grassierende Islamophobie gewandt. »Wir wissen«, sagt Kahn, »dass es überall, wo gegen religiöse Minderheiten gehetzt wird, am Ende auch gegen die Juden geht. Wir sind gegen Kopftuch- und Minarettverbote und verteidigen jedermanns Religionsfreiheit.«
Die Frage ist allerdings, wer für die Freiheit der Juden einsteht, unbehelligt Zeichen ihrer Religion zu tragen wie die Kippa oder den Davidstern. Der Rabbiner der Gemeinde, ein Orthodoxer, wurde auf der Straße mehrfach schon als »Scheißjude« beschimpft, den man »leider vergessen habe zu vergasen«. Seit dem Gazakrieg, sagt Kahn, sei das Klima so feindselig geworden, dass die meisten die Kippa lieber zu Hause lassen. Es gab Brandanschläge auf eine Kapelle, Verwüstungen jüdischer Friedhöfe und Pöbeleien gegen die Teilnehmer eines jüdischen Kinder-Ferienlagers. Etwa 30 jüdische Familien, schätzt der Vorsitzende, hätten die Stadt bereits verlassen, seit die Angriffe zunehmen. Manche gingen nach Stockholm, wo es mehr jüdische Infrastruktur gebe, in der man sich sicher fühlen könne, manche auch nach England oder Israel.
Der sozialdemokratische Bürgermeister der Stadt, Ilmar Reepalu, hat lange geschwiegen. Nachdem Berichte lokaler Medien den Antisemitismus skandalisierten, gab er ein Interview, das in Fred Kahns Augen alles noch schlimmer machte. Reepalu forderte von Malmös Juden, »sich klar von den Menschenrechtsverletzungen des Staates Israel gegen die Zivilisten in Gaza zu distanzieren«. Diese Äußerung kommt einer symbolischen Ausbürgerung gleich. Eine Ungeheuerlichkeit: Müssen sich schwedische Juden von Israel distanzieren, um sich das Recht auf Unversehrtheit als Bürger zu verdienen? Der Bürgermeister aber setzte in einem späteren Interview noch nach: »Wir akzeptieren weder Zionismus noch Antisemitismus noch andere Formen ethnischer Diskriminierung.« Das ist eine subtile Version der Behauptung, der Zionismus sei eine Form des Rassismus wie der Antisemitismus. Ein linker Bürgermeister, der sich nicht vor seine jüdischen Bürger stellt und stattdessen den als »Antizionismus« posierenden Affekt gegen Juden auch noch füttert? »Wenn Juden aus der Stadt nach Israel auswandern wollen, hat das für Malmö keine Bedeutung«, sagte er. Reepalu ist weiter im Amt und wird von seiner Partei gestützt.
In Budapest kommen die Angriffe gegen Juden aus einer anderen politischen Richtung. Ungarn hat mit über 100 000 Mitgliedern die größte jüdische Gemeinde Osteuropas. Nach dem Kollaps des Kommunismus gab es ein wahres Revival jüdischen Lebens. Die größte und schönste Synagoge des Kontinents steht an der Dohany-Straße im Zentrum der Hauptstadt, und Péter Feldmájer, Vorsitzender des ungarischen Zentralrats, residiert in einem holzgetäfelten Büro an ihrer Rückseite. Seine Augen leuchten, wenn er von den Tausenden nichtjüdischen Gästen spricht, die jedes Jahr zum jüdischen Sommerfest kommen. Seine Synagoge ist eine der Hauptattraktionen für Touristen, seit sie aufwendig saniert wurde.
Leider hatten auch die Rechtsradikalen ein grandioses Revival in den letzten Jahren. »Unter dem Kommunismus«, so Feldmájer, »war das alles verboten. Da konnte man es nicht sehen, aber es war immer da. Heute ist es wieder völlig normal, jemanden in der Öffentlichkeit als ›verdammten Juden‹ zu beschimpfen – als hätte der Holocaust nie stattgefunden. Was übrigens viele aus dieser Szene behaupten.«
Kristof Domina, ein junger Politikwissenschaftler, hat soeben das Athena Institute gegründet, einen Thinktank, der sich mit der rechtsradikalen Szene Ungarns beschäftigt. Er hat eine interaktive Karte der hate groups veröffentlicht, darunter 13 aktive Neonazi-Gruppen. Die Internetplattform kuruc.info, die regelmäßig den Holocaust leugnet und zur Gewalt gegen Roma und Juden auffordert, hat nach Dominas Erkenntnissen täglich bis zu 100 000 Besucher – eine erschreckende Zahl in einem Land von 10 Millionen Einwohnern. Kristof ist einer der wenigen nichtjüdischen Kritiker des Antisemitismus im Land. Er hofft, dass Ungarns EU-Ratspräsidentschaft die Aufmerksamkeit für diese Entwicklungen erhöht. Péter Feldmájer wünscht sich eine klare Verurteilung des alltäglichen Antisemitismus durch die Regierung. Aber er glaubt wohl selbst nicht daran. Orbáns konservative Regierungspartei Fidesz zögert, die offen antisemitische Partei Jobbik seit deren Zwölf-Prozent-Wahlerfolg im vergangenen Jahr in die Schranken zu weisen.
Für junge Juden wie die Studenten Tamás Büchler und Anita Bartha, beide Anfang 20, ist es eine Last, sich mit überwunden geglaubten Stereotypen zu beschäftigen. Sie engagieren sich in jüdischen Gruppen – Tamás als Koordinator für die Jewish Agency, Anita für eine lokale Jugendgruppe namens Jachad. Sie suchen eine positive Identität, sie wollen weg von deprimierenden Themen wie Holocaust und Antisemitismus. Die offizielle Vertretung der Juden, finden sie, reite zu viel darauf herum. Sie gehören zu der Generation, die nach dem Kommunismus in Freiheit das Judentum wiederentdecken konnten, das ihre Eltern oft verheimlichen mussten. Die beiden tun die ungarischen Nazis als hässliche Folklore ab. Sie weigern sich, ihr Judentum von außen festlegen zu lassen und ihr Leben in Angst zu verbringen.
Vielleicht sind die Nazis mit ihren Pfeilkreuzen und Árpád-Bannern gar nicht das größte Problem. Anita berichtet von einer Untersuchung, nach der 40 Prozent der Geschichtsstudenten an ihrer Uni antisemitische Klischees vertreten. Tamás geht mit einem Aufklärungsprojekt in Schulklassen und muss immer wieder erleben, dass die Kinder darüber erstaunt sind, dass er keine große Nase hat. Er lacht, aber es klingt ein bisschen bitter. Wenn man die beiden fragt, wo sie ihre Zukunft sehen, lautet die trotzig-stolze Antwort: »Wir müssen nicht hier bleiben, anders als unsere Eltern unter dem Kommunismus.«
Aber zu gehen käme ihnen vor wie Verrat oder Niederlage. Entschieden haben sie noch nichts. Aber es ist beruhigend, die Option zum Gehen oder Bleiben zu haben: »Ich liebe diese Stadt wie verrückt«, sagt Anita. »Es ist die beste Stadt der Welt.«