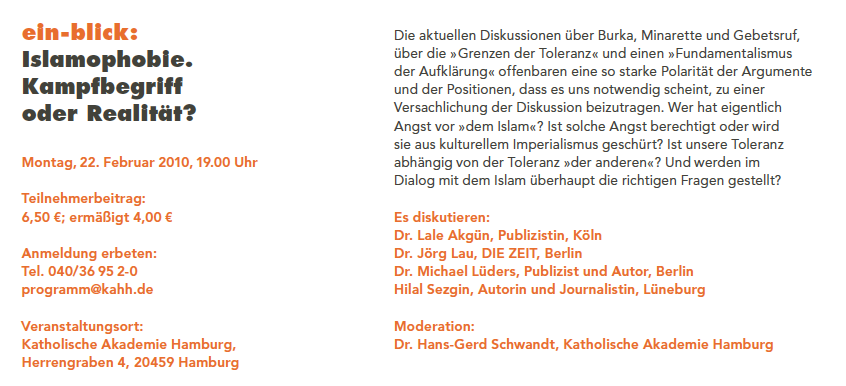In Holland wird die Implosion der politischen Mitte womöglich bald zu einer Regierungsbeteiligung des blonden Bannerträgers des liberalen Rassismus in Europa führen. Deutschland hat und braucht keinen Wilders, wie sich an zwei bemerkenswerten Interviews des Wochenendes zeigen läßt: Der kluge konservative CSU-Mann Alois Glück und der SPD-Innensenator von Berlin Erhart Körting, haben sich bei zu dem Zusammenleben mit Muslimen hierzulande geäußert. Und es ist beispielhaft, wie sie dabei Sorgen und Probleme der Integration einer für Deutschland neuen Religion aufnehmen, ohne Ressentiments zu bedienen:
WELT ONLINE : Herr Glück, Sie haben einen guten Einblick in die islamische Community in Deutschland. Ist zwischen Katholiken und Muslimen eine Kooperation, wenn nicht gar Allianz in ethisch-moralischen Fragen denkbar?
Glück : In Teilen des Islam sehe ich eine solche Kooperationsbereitschaft. Aber es gibt noch Erklärungsbedarf: etwa zu Fragen unserer Verfassung, der Trennung von Staat und Religion, der Freiheit des Religionswechsels, ohne Sanktionen befürchten zu müssen, und zur gleichen Würde der Frau.
WELT ONLINE : Gleiche Würde, das sagen auch Muslime, was freilich noch nicht Bereitschaft zur vollen Gleichberechtigung bedeutet.
Glück : Das ist auch ein kultureller Prozess. Jüngste Untersuchungen in Deutschland zeigen die große Bandbreite der Einstellungen des Islam. Als grobe Orientierung kann man sagen: Je stärker Muslime säkularisiert sind, umso mehr schätzen sie unsere Verfassungs- und Gesellschaftsordnung. Seien wir ehrlich: Auch wir haben einen kulturellen Prozess durchgemacht. Ich kenne noch die geschlossenen Gesellschaften der 50er- und 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in denen die Gleichberechtigung der Frau nicht voll akzeptiert wurde. Das gilt auch für Teile unserer Kirche.
WELT ONLINE : Sehen Sie in den Islam-Verbänden Ansätze einer Hinwendung zu einem europäischen, vielleicht deutschen Islam?
Glück : Es gibt niemanden, der für das Ganze sprechen kann, das ist ein unglaublich schwieriges Problem. Wir sehen große Spannungen etwa zwischen Sunniten und Schiiten. Wir haben, was unsere Verfassung betrifft, eine große Zustimmung beispielsweise bei den Aleviten, aber auch anderen Gruppen. Die Verbände sind aber noch stark geprägt vom Islam der Herkunftsländer. Es ist ganz dringlich, dass wir zu Ausbildungen in Deutschland kommen, auch, was die Imame angeht. Es gibt nach meiner Erfahrung viele Muslime, die unsere Kultur bejahen und zugleich ihren Glauben leben. Es ist ein großer Unterschied, ob in eine Ditib-Moschee ein Imam kommt, der einige Jahre hier ist und dann wieder in die Türkei zurückkehrt, oder ob es Menschen sind, die sich hier entwickelt haben. Das ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die wir aber nicht ohne die Muslime lösen können.
WELT ONLINE : Das heißt, die Verbände sollen einbezogen werden?
Glück : Wir können sie nicht ausschalten, müssen aber wissen, dass sie, wie die Untersuchungen zeigen, eben nicht den ganzen Islam vertreten. Auch wenn wir immer wieder Enttäuschungen erleben sollten, müssen wir mit konstruktiven Kräften kooperieren. Und wir müssen die tief verwurzelten Ängste in unserer Bevölkerung ernst nehmen.
WELT ONLINE : Leidet die deutsche Gesellschaft an Islamophobie? Der Berliner Historiker Wolfgang Benz hat Parallelen zum Antisemitismus gezogen.
Glück : Die Parallele halte ich für falsch. Solche Vergleiche verbieten sich. Es gibt eine Angst, die vielfältige Ursachen hat: die Türken vor Wien, der Terrorismus durch fanatische Muslime, Angst vor Überfremdung. Es gibt viele Anfragen an die Muslime. Es geht nicht nur um den guten Willen unsererseits, es geht auch um die Integrationsbereitschaft der Muslime in eine Gesellschaft, die christlich-abendländisch geprägt ist. Zu ihr gehören Toleranz und Freiheit der Religionsausübung in all ihren Formen. Insofern ist es auch kein Widerspruch, die kulturellen Prägungen unseres Landes durch das Christentum zu betonen und gleichzeitig offen zu sein für ein ehrliches Zusammenleben mit den Muslimen ?
WELT ONLINE : … was in islamischen Ländern die umgekehrte Wirklichkeit ist ?
Glück: … aber wir nicht zum Maßstab unseres Handelns machen dürfen. Wir dürfen nicht wegen einer solchen Wirklichkeit in anderen Ländern oder des Verhaltens einer Minderheit hierzulande die Werte unseres Grundgesetzes relativieren.
(Alles lesen).
Und Körting im Tagesspiegel:
„Wir sind ein hochtechnisiertes Land, in dem Sie nur dann einen guten Lebensstandard erwirtschaften können, wenn Sie über sehr viel Bildung und Ausbildung verfügen. Es mag für den Einzelnen noch funktionieren, wenn er sagt, ich bin es gewohnt, mit wenig auszukommen und lasse mir von Vater Staat helfen. Aber spätestens an den Kindern versündigen sich diese Leute. Seinen Kindern das zuzumuten, was man selbst aus Palästina oder anderswo kennt, ist nicht in Ordnung. Sie grenzen damit ihre Kinder von der Gesellschaft ab. Wer nicht bereit ist, das Bestmögliche für seine Kinder zu tun, muss damit rechnen, dass sie kriminell werden und abdriften.
Wie kommt es, dass in der Öffentlichkeit immer von Türken und Arabern die Rede ist, wenn es um Integrationsprobleme in Berlin geht? Machen andere Gruppen keine Schwierigkeiten?
Es gibt eine europäische Kulturidentität, die Integration erleichtert. Diese Identität haben beispielsweise Italiener, Spanier, Polen, in Teilen auch Russen und Ukrainer. Höchstwahrscheinlich auch Menschen aus Ankara und Istanbul. Bei Leuten aus Mardin, im Osten der Türkei, gibt es diese Kulturidentität schon nicht mehr, weil sie dort in einer Welt leben, die sich in vielen Bereichen sehr von unserer unterscheidet. Und deshalb sind bei diesen Menschen mehr Anstrengungen erforderlich, um Integration zu erreichen, als bei anderen.
Es heißt aber doch oft, Vietnamesen seien in Deutschland am besten integriert. Die haben mit der europäischen Kultur kaum Berührungspunkte, wenn sie herkommen.
Das hat wiederum nichts mit der Kultur zu tun, ebenso wie bei Chinesen, Armeniern oder anderen kleinen Gruppen. Zuwanderer, die zahlenmäßig nicht in großen Communities leben, sind stärker gezwungen sich zu integrieren, wenn sie überleben wollen.
Die türkische Regierung erklärt, es leben in 118 Ländern rund 5 Millionen Auslandstürken, davon über zwei Millionen allein in Deutschland. Ist die große Zahl ein Nachteil für ihre Integration?
Nachteil klingt immer so negativ. Ich würde sagen, je größer die Gruppe ist, desto größer müssen die Integrationsanstrengungen sein. Die große Gruppe hat einen Vorteil: Die Menschen fühlen sich emotional gebunden und sicher. Der Nachteil ist, dass große Gruppen schnell ein Eigenleben entwickeln, mit eigenen Geschäften, Gaststätten, Ärzten etc. Das Phänomen gibt es nicht nur in Bezug auf Türken, sondern auch Araber in Neukölln und manche Russen in Marzahn-Hellersdorf. Das Paradebeispiel sind junge Menschen aus der Türkei, die in Deutschland in eine türkische Familie einheiraten und hier keinerlei Bedürfnis entwickeln, Deutsch zu lernen. Sie können so weiterleben wie in der Türkei. Diese Situation erschwert die Integration in der Gesamtgesellschaft.
Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, dass wir auch deshalb ein Problem mit Integration haben, weil sich der türkische Staat noch immer politisch verantwortlich fühlt und einmischt. An anderer Stelle sagten Sie, „das hat keine konkreten Auswirkungen auf die hier lebenden Türken“. Was stimmt nun?
Zu sagen, die Türkei ist schuld an unseren Integrationsproblemen, wäre viel zu verkürzt. Aber auch der türkische Staat muss akzeptieren, dass die Menschen aus der Türkei, die hier leben, Auswanderer sind. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass einige türkische Politiker eine Vormundschaft für türkische Bürger beanspruchen. Kritisch wird es, wenn einige vermitteln, „ihr seid zwar ausgewandert, aber eigentlich gehört ihr noch zur Türkei und werdet überall schlecht behandelt außer bei uns“. Das ist desintegrativ.