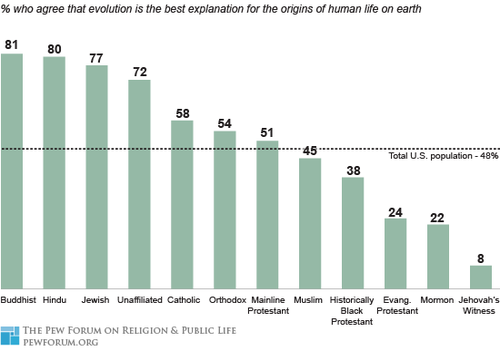Mein Kommentar zum innenpolitischen Guantánamo-Streit aus der ZEIT (Nr. 6, 2009) von morgen:
Der Wandel, den Barack Obama versprochen hat, kommt nicht nur nach Washington, sondern auch nach Berlin.
Kaum eine Woche ist der neue Präsident im Amt, und schon steht die deutsche Innenpolitik kopf: Jürgen Trittin von den Grünen wirft Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) »blanken Antiamerikanismus« vor. Und seine Kollegin Renate Künast sekundiert, indem sie die »Undankbarkeit« von CDU und CSU gegenüber den Amerikanern anprangert: »Ich erinnere nur an den Marshallplan, die Carepakete, die Berliner Luftbrücke. Wie kann man da heute sagen, die USA sollen das Problem selber lösen?«
Das »Problem« ist die Unterbringung der etwa 60 Gefangenen in Guantánamo, die als unschuldig oder ungefährlich gelten und nach Schließung des Lagers dennoch nicht in ihre Heimatländer zurückkehren können, weil ihnen Verfolgung und Folter drohen. Führende Unionspolitiker hatten gefordert, die Amerikaner sollten die Gefangenen gefälligst selber unterbringen.
Muss, wer Carepakete genommen hat, auch entlassene Gefangene nehmen? Ist Guantánamo ein rein amerikanisches Problem, das uns nichts angeht? Weder noch. Wie Deutschland sich am Ende verhalten wird, ist denn auch ziemlich klar: Es kann weder eine prinzipielle Absage noch eine pauschale Zusage geben. Man wird auf eine eventuelle Anfrage der Amerikaner mit dem Angebot einer europäischen Lösung antworten: Nennt uns 20 oder 30 Gefangene, wir werden jeden Einzelfall prüfen und die Unbedenklichen dann auf die willigen Länder verteilen. Und das leuchtet auch ein: Nachdem wir jahrelang Bush für die Demontage des Rechtsstaates kritisiert haben, werden wir seinem Nachfolger bei dessen Wiederherstellung zur Hand gehen. Klare Sache.
Wirklich? Die Debatte der letzten Woche nährt Zweifel. Es hat sich ein bitterer Streit entzündet, der mit einem erstaunlichen Rollenwechsel einhergeht. Rot-Grün stimmt nun das alte transatlantische Tremolo von Deutschlands historischer Bringschuld gegenüber der amerikanischen Schutzmacht an. Carepakete! Luftbrücke! War man nicht unter Bush noch stolz, endlich erwachsen geworden zu sein? Und nun doch zurück in die Zukunft des Kalten Krieges?
Die Union wird im Gegenzug – gemeinsam mit dem schwarz-gelben Schatten-Außenminister Westerwelle – derart patzig gegenüber den Amerikanern, dass fast ein Hauch von Schröders Goslarer Nein in der Luft liegt. Räumt euren Mist selber auf! Verkehrte Welt: Hat die Union Steinmeier nicht seinerzeit im Untersuchungsausschuss für seine Hartleibigkeit im Fall Murat Kurnaz kritisiert? Jetzt unterstellt Schäuble dem SPD-Kollegen, er untertreibe die Gefahr, die von den Entlassenen ausgehen könnte, weil er sich bei Obama lieb Kind machen wolle.
Dass die deutschen Parteien mit einem nervösen Rollenspiel auf die Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik reagieren, ist ein Krisensymptom. Durch den neuen Präsidenten ist ungeahnte Verunsicherung ins einst so festgezurrte transatlantische Verhältnis gekommen. Obama erzeugt ganz offenbar erheblichen Stress auch auf unserer Seite des Atlantiks. Paradoxerweise besonders dann, wenn er alte Lieblings-Forderungen der Europäer erfüllt.
Man sollte die Debatte darum nicht als bloßes Wahlkampfgetöse abtun. Sicher wollen die einen gerne im Kielwasser von Obamas change segeln, und die anderen möchten sich als knallharte Sicherheitspolitiker profilieren. Aber insgeheim ahnen beide Seiten schon, dass Obamas Weg auch von Deutschland eine Neuausrichtung jenseits von Rechts und Links verlangt.
Die Guantánamo-Debatte ist bloß der Anfang eines Gesprächs über die neue Lastenverteilung im Westen. Das Lager zu schließen ist nämlich die Voraussetzung für eine neue Politik gegenüber dem Nahen Osten, die wir lange gefordert haben. Gerade diese wird Deutschland noch vor härtere Fragen stellen. Der neue diplomatische Ansatz gegenüber Iran: Was darf er die deutsche Industrie kosten? Denn ohne schärfere Wirtschaftssanktionen wird Obamas Bereitschaft, mit den Mullahs zu sprechen, nichts bringen. Und falls Obama uns anbietet, über eine neue Strategie in Afghanistan zu reden – was könnte von uns zusätzlich kommen? Geld? Truppen? Andere Mandate? Sollte Amerika wie angekündigt eine ausgeglichenere Politik gegenüber Israel und den Palästinensern verfolgen, würden wir unseren israelischen Freunden bittere Wahrheiten über den Siedlungsbau und die Checkpoints sagen?
Wie die Antworten auf diese Fragen ausfallen, wird zeigen, ob Deutschland wirklich ein freies, erwachsenes Verhältnis zu Amerika gefunden hat. Bush hat es uns sehr einfach gemacht. Er hat nicht nur in Amerika das »kindische« Wesen befördert, das Obama überwinden will. Zu Obama Nein zu sagen wird eine schwierigere Sache. Und Ja zu sagen auch.