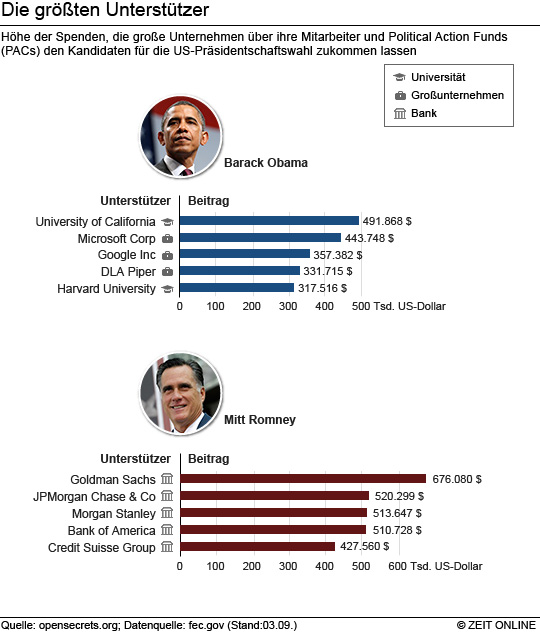Gleich neben der Tagungshalle spielt ein Saxophonist. Im Park gegenüber haben Umweltschützer, Schwulengruppen und Dutzende anderer Aktivisten ihre Stände aufgebaut. Auf einer Bühne um die Ecke haut ein Rockgitarrist in die Saiten. Und an der Straßenkreuzung brüllen religiöse Fanatiker Bibelverse ins Megaphon. Eltern stellen sich samt Kind und Kegel zum Familienphoto vor eine Obama-Statue aus Sand, die der Ort Myrtle Beach gestiftet hat.
Tausende von Menschen schlendern durch die Straßen, schlecken Eis und wiegen die Hüften zur Musik. Der Parteitag der Demokraten in Charlotte, North Carolina, gleicht bisweilen eher einem Volksfest. Man könnte fast vergessen, dass es in der Warner Arena, einer Basketballhalle mitten im Zentrum der Stadt, um ernste Politik geht. Dass hier ein Präsident um seine bedrohte Wiederwahl kämpft.
Doch der größte Unterschied zu dem eher wie eine Aktionärsversammlung aufgezogenen Kongress der Republikaner in der Woche davor: Es ist ein kunterbuntes Publikum, neben den weißen Amerikanern viele Schwarze, Asiaten, Latinos, Indianer. Es ist ein anderes Amerika, das sich hier in Charlotte präsentiert.
Dem demographischen Wandel hinterher
Nicht, dass bei den Republikanern keine Afroamerikaner oder Hispanics aufgetreten wären. Die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice, Marco Rubio, Senator aus Florida, die Latino-Gouverneure der Bundesstaaten New Mexico und Nevada – das war eine stattliche Riege von Prominenz, die Ihresgleichen sucht. Doch sie standen auf der Bühne. Das Parteivolk unten in den Rängen war fast ausschließlich weiß.
Manche mögen jetzt sagen, solche Vergleiche verböten sich in einem Schmelztiegel-Land, dessen Grundsatz „e pluribus unum“ heißt: aus vielen das eine. Einige nennen diese Vergleiche sogar rassistisch. Doch das Land und seine Parteien reden selber ständig darüber. Der Republikaner Jeb Bush, Ex-Gouverneur von Florida und Bruder des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, schrieb seiner Partei auf ihrer Versammlung in Tampa ins Stammbuch, sie drohe den demographischen Wandel Amerikas zu verpassen. Die einwanderungsfeindliche Rhetorik einiger Parteifreunde nannte er „dumm“.
Das bunte Amerika ist die Zukunft
Unermüdlich zerlegen Demoskopen und Wahlstrategen das amerikanische Volk in seine Einzelteile: in Hispanics und Afroamerikaner, in Asiaten und Weiße. Und diese Gruppen werden wieder unterteilt, bis man irgendwann bei Frauen und Männern mit und ohne Kinder gelandet ist, alleinerziehend oder nicht, mit und ohne Arbeit, Vorstädter oder Großstädter. Undsoweiter.
Es gehört in Amerika seit Langem dazu, Makrotrends in Mikrotrends aufzusplitten. Und dabei kommt man nicht umhin festzustellen: Dass sich bei den Demokraten das bunte, das vielschichtige und in seinen Einzelteilen so unterschiedliche Amerika zeigt. Und alle Demographen und Meinungsforscher, egal, welcher Partei sie nahestehen, sagen: Dieses Amerika sei die Zukunft. Und wenn Republikaner auch in zehn, zwölf Jahren eine Chance auf politische Mehrheiten haben wollen, müssen sie dieses so viel bunter gewordene Amerika umarmen.