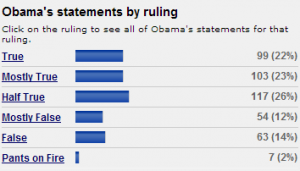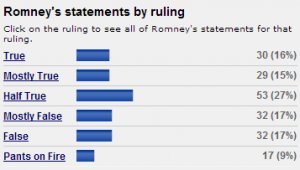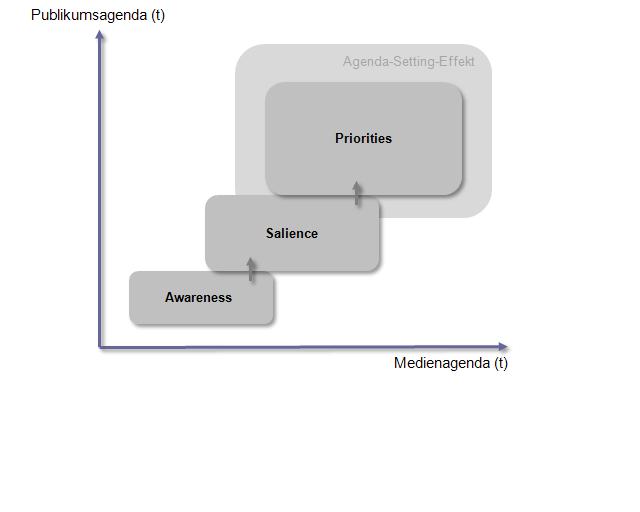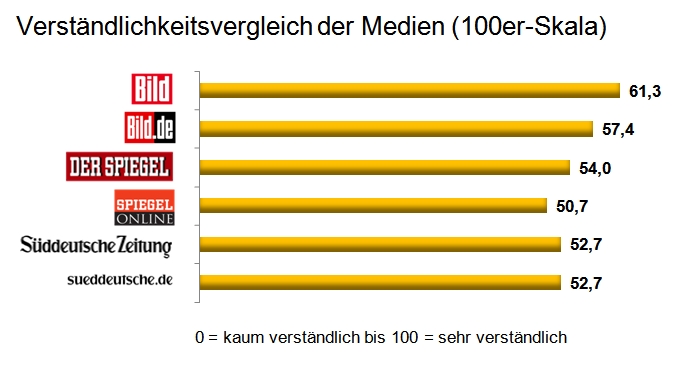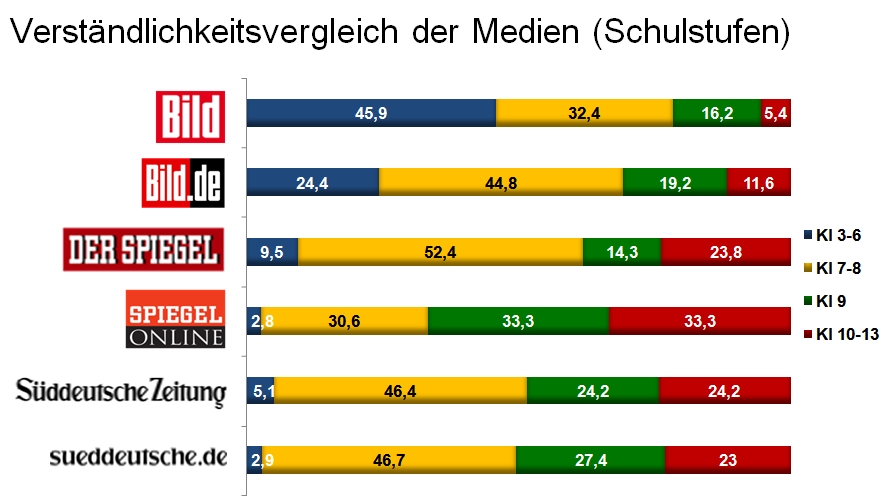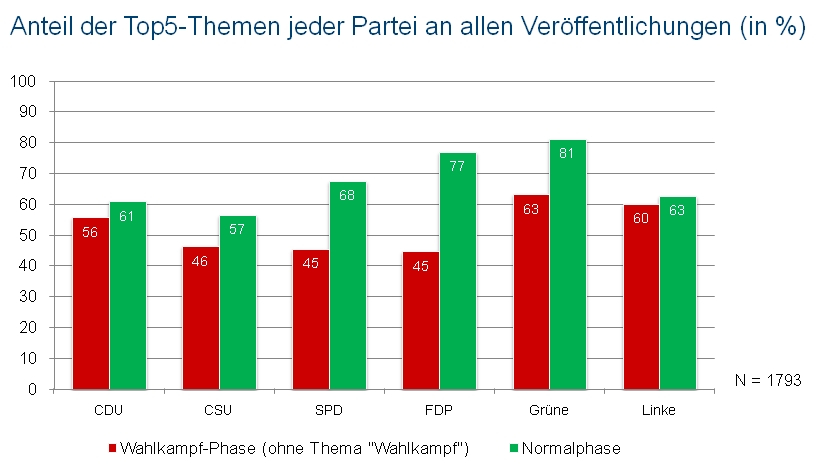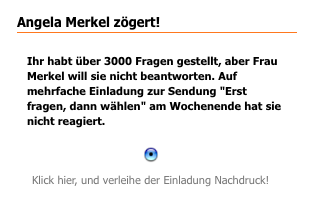Gastbeitrag von Christoph Bieber
 Was haben die „Enthüllungsplattform“ Wikileaks und die scheinbar nur für Verwaltungsexperten und Programmierer interessanten E-Government-Angebote wie data.gov, data.gov.uk oder bund.offenerhaushalt.de miteinander gemein? Auf den ersten Blick nicht viel, doch bei einem Vergleich der Konstruktionsprinzipien zeigen sich durchaus Ähnlichkeiten: In beiden Fällen geht es um „offene Daten“, die Verfügbarmachung und Verbreitung großer Informationsmengen, ganz gleich ob als subversive Enthüllung oder kontrolliertes Leck.
Was haben die „Enthüllungsplattform“ Wikileaks und die scheinbar nur für Verwaltungsexperten und Programmierer interessanten E-Government-Angebote wie data.gov, data.gov.uk oder bund.offenerhaushalt.de miteinander gemein? Auf den ersten Blick nicht viel, doch bei einem Vergleich der Konstruktionsprinzipien zeigen sich durchaus Ähnlichkeiten: In beiden Fällen geht es um „offene Daten“, die Verfügbarmachung und Verbreitung großer Informationsmengen, ganz gleich ob als subversive Enthüllung oder kontrolliertes Leck.
Folgerichtig entwickelt sich in den USA bereits eine Debatte um die Frage, ob Wikileaks in das Modell des „Open Government“ passt (vgl. Alex Howard, Is Wikileaks Open Government?). In Deutschland dominieren dagegen die Bestürzung über die unverblümten Einschätzungen des politischen Spitzenpersonals sowie eine diffuse Empörung über das Internet als sprudelnder Datenquelle. Immerhin, in der öffentlichen Debatte wird Wikileaks als Akteur nun etwas mehr Respekt entgegengebracht – in den Affären um die Publikation geheimer Militärdokumente galt das Netzwerk um Julian Assange eher als medialer Emporkömmling mit unklarem Antrieb. Besonders pointiert vorgetragen wurde die Frage nach dem Bedeutungsverlust der alten Medien durch den New Yorker Journalismus-Forscher Jay Rosen, der Wikileaks als neuartige „stateless news organization“ bezeichnet hatte.
Die ersten beiden Publikationswellen waren deutliche Hinweise darauf, dass die technologisch veränderten Möglichkeiten zur Dokumentenerstellung, -vervielfältigung und -weitergabe für eine „Konjunktur des Lecks“ sorgen. Hier liegt im Übrigen eine bislang noch kaum beachtete Differenz zu den „War Logs“ aus Afghanistan und Irak: Waren damals auch multimediale Dokumente veröffentlicht worden, handelt es sich bei den diplomatischen „Kabeln“ bislang offenbar um pures Textmaterial. Gerade hier sind gemeinschaftliche Anstrengungen notwendig, um sich mit der immensen Materialmenge überhaupt beschäftigen zu können. Profiteure sind hier nicht allein Journalisten und interessierte Bürger, sondern auch Wissenschaftler. So gerät der britische Historiker Timothy Garton Ash angesichts dieser Quellenflut regelrecht ins Schwärmen:
„In den nächsten Wochen können wir uns auf ein mehrgängiges Festmahl zur Geschichte der Gegenwart freuen. Ein Historiker muss normalerweise 20 bis 30 Jahre warten, um solche Schätze zu finden. Hier sind die jüngsten Berichte kaum älter als 30 Wochen. Diese Fundgrube enthält mehr als 250.000 Dokumente. (…) Wie alle Archivforscher wissen, eröffnet die Untersuchung großer Datenmengen neue Einsichten – seien es die Briefe eines Schriftstellers, Unterlagen aus einem Ministerien oder diplomatischer Schriftverkehr. Das gilt auch dann, wenn vieles nur Routinematerial ist, denn ein langes Eintauchen in den Stoff schärft den Sinn für Prioritäten, Charakter und Denkmuster.“
Eine zweite Unterscheidung liegt in der Verortung des geleakten Materials innerhalb des politischen Systems: Aus politikwissenschaftlicher Perspektive können die ersten beiden „Datenhaufen“ als ein Leck im policy-Bereich verstanden werden, denn im Mittelpunkt stand die Einflussnahme auf konkretes außenpolitisches Handeln mit dem Ziel der Diskreditierung der militärischen Konflikte als legitimes politisches Mittel. Die dritte durch Wikileaks geöffnete Material-Fundgrube enthält (sofern man das bisher sagen kann) dagegen eher Informationen aus dem politics-Bereich und wirft Licht auf die Art und Weise, wie innerhalb und zwischen politischen Organisationen und Institutionen kommuniziert worden ist. Die Orientierung auf den politischen Prozess verschiebt auch die Bedeutungsebene dieses dritten Lecks – die ersten beiden Veröffentlichungswellen dürften sich in der Rückschau als die brisanteren erweisen.
Offene Daten-Plattformen als kontrollierte Lecks?
Man darf also vermuten, dass das „Leck“ als Standardsituation öffentlicher Kommunikationsprozesse vor einer großen Karriere steht. Nicht zuletzt, weil dafür auch einige Projekte sorgen, die auf Regierungsseite vorangetrieben werden und sich ebenfalls mit der gezielten Veröffentlichung großer Datenmengen befassen – gewissermaßen ein bewusstes „leaking“ durch staatliche Stellen. Beispiele für diese „Open Data“-Initiativen sind Portale wie data.gov in den USA oder data.gov.uk in Großbritannien. In Deutschland zielt offenerhaushalt.de in eine ähnliche Richtung, ist im Gegensatz zu den vorgenannten jedoch kein offizielles Regierungsprojekt.
Auch diese Leuchtturmprojekte dokumentieren einen veränderten Umgang mit öffentlich verfügbaren Daten und Informationsmaterial – und wie bei Wikileaks stehen dabei radikale Publizität und Transparenz im Vordergrund. In einem offenen, auf Kollaboration angelegten Arbeitsumfeld sollen neue Produkte und Dienstleistungen entstehen, die der Allgemeinheit zugute kommen und staatliche Akteure in der Ausübung ihrer Tätigkeiten unterstützen. Der Ansatz dieses „Open Government“ überträgt die Ideen des auf Offenheit, Beteiligung und Rekombination ausgelegten Web 2.0 in die Umgebung regierungsgebundener Dienstleistungen. Und auch hier geht es um eine Verschiebung von Machtstrukturen, schreiben die Management- und Verwaltungswissenschaftler Ai-Mei Chang und P. K. Kannan: „Aus einer Perspektive der Regierungsinstitutionen zielen Fragen zur gemeinsamen Entwicklung von Services und Regulierungsfragen auf (1) die Machtverschiebung in Richtung der Nutzer sowie (2) das Verhältnis zwischen Nutzern und externen Organisationen, die als Vermittler für andere auftreten.“
Wesentliche Triebfeder für Projekte mit offenen Daten ist die Idee der Co-Creation neuer Inhalte im Rahmen flexibler, datengestützter Kooperationen zwischen Bürgern und öffentlichen Akteuren. Ziel ist dabei nicht etwa eine vertragsbasierte Zusammenarbeit, sondern die Hoffnung auf individuelle Weiterentwicklungen und Re-Kombinationen der öffentlich verfügbaren Daten durch Dritte. Auffallend ist dabei auch, dass bereits mehrere Non-Profit-Organisationen den Datenreichtum solcher staatlichen Repositorien systematisch auszuschöpfen versuchen. Dazu zählen die „Open Knowledge Foundation“ mit Sitz in England und Wales, die US-amerikanische „Sunlight Foundation“ und auch die deutschen Netzwerke „Open Data e.V.“ und Government 2.0 e.V.
Sichtbar wird hier eine starke Verankerung in einer „digitalen Zivilgesellschaft“, deren Akteure als Übersetzer tätig werden und mit Hilfe von Auswertungen und Visualisierungen die Informationen einem größeren Publikum zugänglich machen. Zugleich stehen sie damit aber auch öffentlichen Verwaltungsstrukturen helfend zur Seite, denn aufgrund begrenzter Ressourcen sind die Behörden oft nicht in der Lage, die enormen Datenmengen ausführlich zu erschließen und aufzubereiten.
Das Konstruktionsprinzip der Plattformen, die in den USA und auch in Großbritannien sehr positiv aufgenommen wurden, weist also tatsächlich einige Ähnlichkeiten mit der ursprünglichen „Geschäftsidee“ von Wikileaks auf. Schließlich hatte die Nicht-Regierungsorganisation ihre Arbeit zunächst als offene Plattform zur Verbreitung von Informationen begonnen, von dem bereit gestellten Rohmaterial sollten Dritte profitieren und durch eine Weiterbearbeitung der Daten einen gesellschaftlich relevanten Mehrwert generieren – erst mit der Publikation der „Afghan War Logs“ wandelte sich dieses Selbstverständnis hin zu einem eher investigativ-journalistisch handelnden Akteur mit einer eigenen politischen Agenda.
Dennoch basieren „Enthüllungs-Website“ und „Verwaltungs-Plattform“ auf ganz ähnlichen Funktionsprinzipien: Sie machen umfangreiche Datenmengen einer größeren Zahl von Menschen zugänglich, und sie erlauben denjenigen, die über die nötigen Kompetenzen und eine individuelle Motivation verfügen, einen kreativen Umgang damit. Somit entsteht in beiden Fällen die Grundkonstellation für eine innovative, online-basierte Politik- bzw. Gesellschaftsberatung.
Interessanterweise scheinen die offiziellen Regierungs-Aktivitäten einer offeneren Struktur zu folgen, als das weder hierarchiefreie noch transparent arbeitende Wikileaks-Netzwerk. Bei den Verwaltungsplattformen steht tatsächlich der Gedanke einer offenen, gleichberechtigten Kollaboration im Vordergrund. In einer sehr vorläufigen und durchaus paradoxen Schlussthese könnte man also festhalten: Während die Regierungsplattformen eher als ein (ergebnis-)offener Prozess der Gesellschaftsberatung zu charakterisieren sind, lassen sich die Bemühungen von Wikileaks als eine in zielgerichtetes Beratungshandeln verkleidete Intervention verstehen, wobei eine bestehende Agenda unter Nutzung vernetzter medialer Öffentlichkeiten gegenüber politischen Akteuren durchgesetzt werden soll.
Textnachweis
Der Text ist eine gekürzte, aktualisierte Fassung des Beitrags „Offene Daten – neue Impulse für die Gesellschaftsberatung? Die Online-Plattformen Wikileaks.org und Data.gov als internet-basierte Gestaltungsöffentlichkeiten“, der in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift für Politikberatung erscheint (Nr. 3/4, 2010).
Der Autor
Dr. Christoph Bieber ist Politikwissenschaftler an der der Justus-Liebig-Universität Gießen, bei Twitter hört er auf den Namen @drbieber. Im Oktober ist sein Buch „politik-digital. Online zum Wähler“ im Blumenkamp Verlag erschienen.