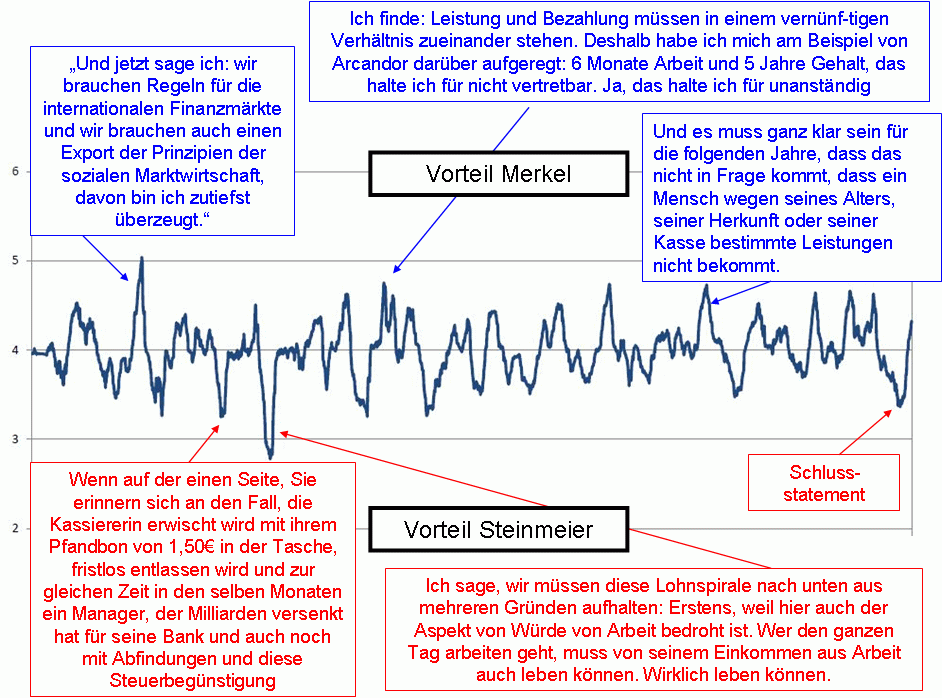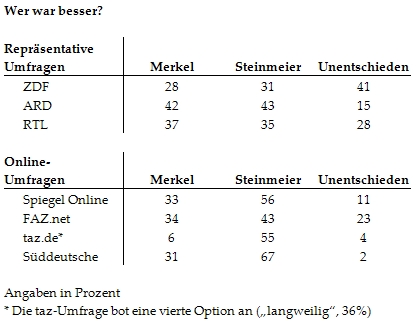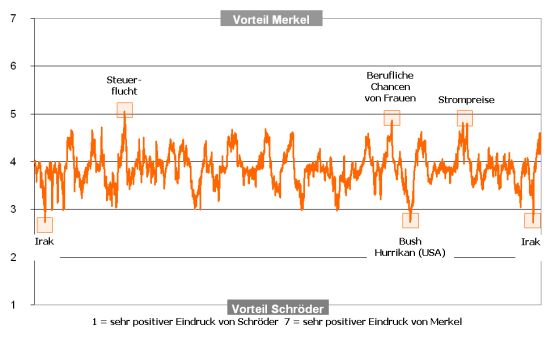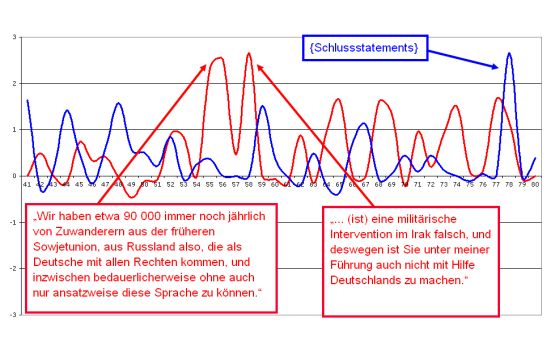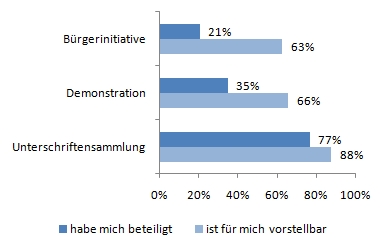Wahlkämpfe werden oft als Geldvernichtungsmaschinen charakterisiert. Dabei sind die Budgets der deutschen Parteien sowohl im Vergleich zu Werbeetats der Privatwirtschaft als auch im internationalen Vergleich keinesfalls maßlos. Aber es wird in der Tat für ein Ereignis sehr viel Geld ausgegeben. Mitunter tragen Wahlkampfreserven (wie 2005 bei der SPD) zu Wahlerfolgen bei bzw. kosten auf der Zielgerade Stimmen (wie möglicherweise 2005 bei der CDU). Insbesondere mit Blick in die USA kann der Eindruck entstehen, dass die Höhe des Wahlkampfbudgets über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Wahlkämpfe werden oft als Geldvernichtungsmaschinen charakterisiert. Dabei sind die Budgets der deutschen Parteien sowohl im Vergleich zu Werbeetats der Privatwirtschaft als auch im internationalen Vergleich keinesfalls maßlos. Aber es wird in der Tat für ein Ereignis sehr viel Geld ausgegeben. Mitunter tragen Wahlkampfreserven (wie 2005 bei der SPD) zu Wahlerfolgen bei bzw. kosten auf der Zielgerade Stimmen (wie möglicherweise 2005 bei der CDU). Insbesondere mit Blick in die USA kann der Eindruck entstehen, dass die Höhe des Wahlkampfbudgets über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Eine kleine Forschergruppe an der Universität Mannheim war und ist weniger an den Budgets der Parteien interessiert, sondern an den Ausgaben der einzelnen Bundestagskandidaten. Für viele von ihnen geht es um das berufliche Überleben, und das hängt primär vom Erfolg der eigenen Partei ab, zu einem gewissen Grad aber auch vom eigenen Einsatz. Deshalb erwarteten wir geringere Budgets bei reinen Listenkandidatinnen und -kandidaten, höhere bei Wahlkreis- und schließlich die höchsten bei Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten der Volksparteien, die eine reale Chance haben, das Mandat auch tatsächlich zu gewinnen. Gespannt waren wir aber auch darauf, wie hoch das Budgets eines durchschnittlichen Kandidaten ist, und darauf, wie viel Geld er oder sie selbst in den eigenen Wahlerfolg investiert.
Für die gut 1.000 Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien, die sich an unserer Befragung beteiligt haben, können wir sagen, dass sie im Durchschnitt 10.600 € im letzten Bundestagswahlkampf ausgegeben haben. Die Extremwerte waren 0 € und 150.000 €. Von ihren Parteien bekamen sie im Schnitt 46% dieser Ausgaben finanziert, doch im Durchschnitt 5.700 € Euro (54%) trugen sie entweder selbst bei oder es gelang ihnen, einen Teil davon über Wahlkampfspenden zu finanzieren. Die Parteianteile variierten dabei sehr stark, denn die CSU-Kandidatinnen und -Kandidaten finanzierten gerade einmal 4% über die Parteikasse, die der Grünen immerhin 70%.
Unsere anreizspezifischen Annahmen spiegelten sich ebenfalls gut in den Umfrageergebnissen wider. Wer nur auf einer Parteiliste kandidierte, gab im Durchschnitt lediglich 2.600 € für den Wahlkampf aus, wobei die Spannbreite von durchschnittlich 1.000 € bei den Grünen bis 9.700 € bei der CSU vergleichsweise moderat war. Die Wahlkreiskandidaten von CDU, CSU und SPD gaben im Durchschnitt über 22.000 € für den Wahlkampf aus, wobei die reinen Wahlkreiskandidaten der CDU mit durchschnittlich 39.700 € am meisten investierten. Während bei den SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten die Partei mehr als die Hälfte der Ausgaben übernahm, waren es bei CDU und CSU je nach Kandidaturform (nur Wahlkreis oder beides) nur zwischen 0% und 16%. Die Budgets der Wahlkreiskandidaten von FDP, Grünen und Linke waren übrigens erheblich niedriger (2.300€ bis 9.200 €) mit Parteianteilen der Finanzierung zwischen 40% (FDP, Liste und Wahlkreis) und 80% (Grüne, nur Wahlkreis).
Nicht nur die Parteien lassen sich demnach den Wahlkampf einiges kosten. Die Budgets der Wahlkreiskandidaten der Volksparteien sind beträchtlich, und der eigene Beitrag für die Wahlkampfkasse ist ebenfalls erwähnenswert. Wer nur „Listenfüller“, vor allem einer kleineren Partei ist, gibt auch erheblich weniger für den Wahlkampf aus. Die eigene Partei schießt fast immer Geld hinzu, denn die lokale, personifizierte Sichtbarkeit der Kandidatinnen und Kandidaten ist keine unwichtige Komponente im Werben um Erst- und Zweitstimmen.
Literatur: Wüst/Schmitt/Gschwend/Zittel in German Politics 15 (4), 2006.