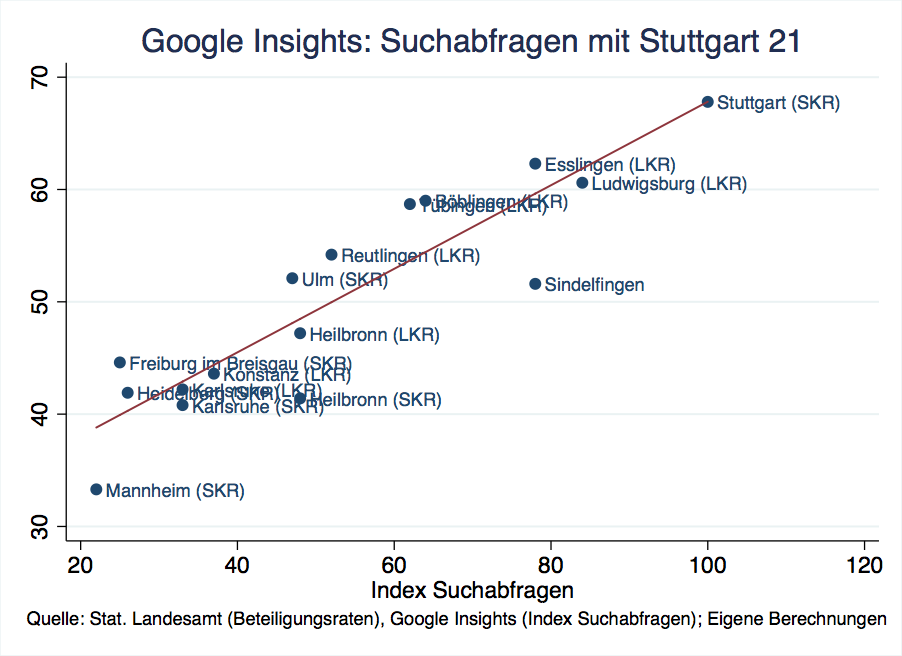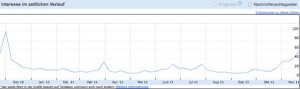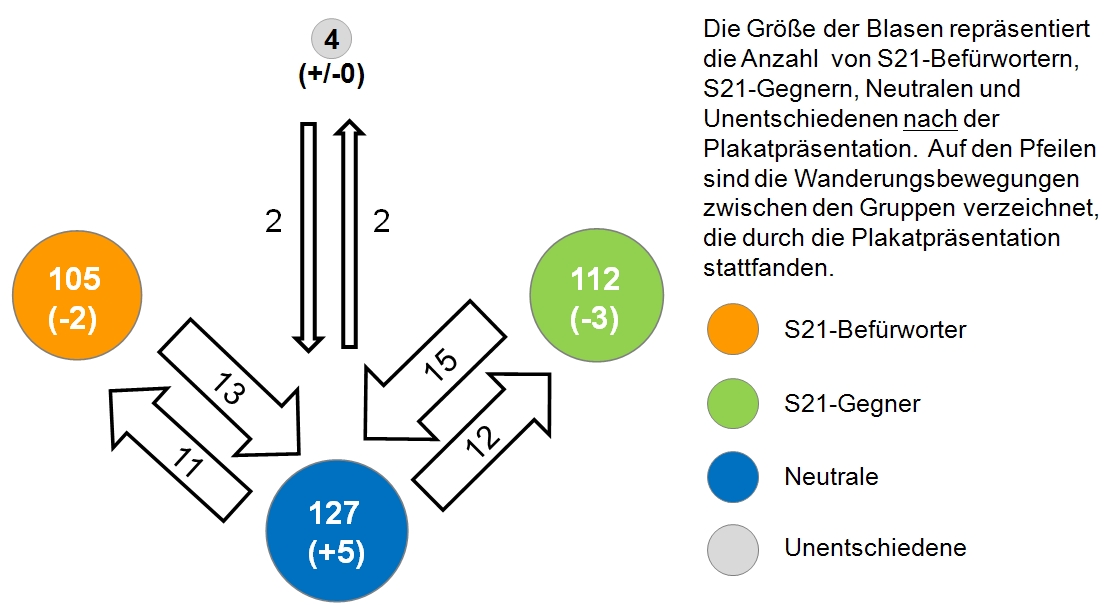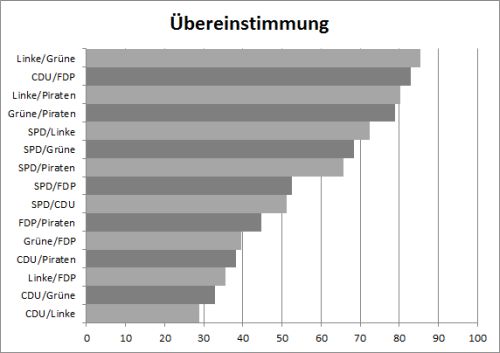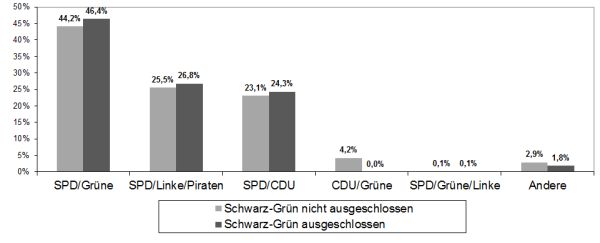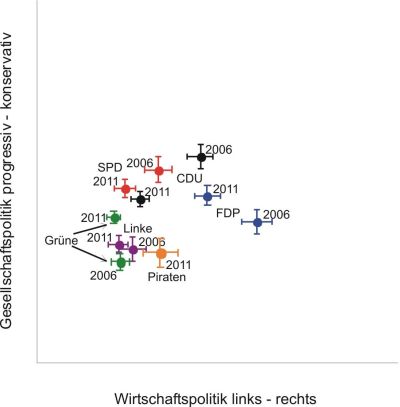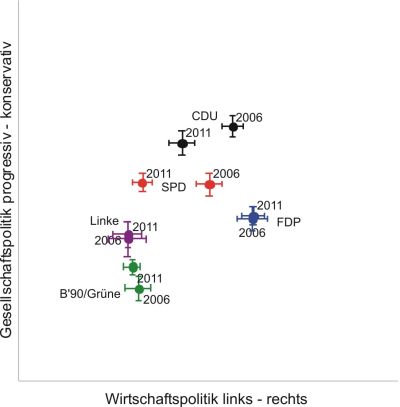Die Rolle und das Amt des Bundespräsidenten werden in der empirischen Sozialforschung kaum beachtet; zu gering ist sein Einfluss, auch wird er nicht direkt gewählt. Dementsprechend wird das Amt auch in der Diskussion um die Personalisierung von Politik nicht beachtet. Dennoch sollen hier einige der wesentlichen und empirisch fundierten Erkenntnisse der empirischen Wahlforschung präsentiert werden, die sich auf die momentane Debatte um Christian Wulff übertragen lassen.
Die Personalisierung der Politik bzw. des Politischen wird in der Politischen Kommunikationsforschung und in der Wahlforschung schon seit geraumer Zeit erforscht. In anderen Worten: Man stellt sich der Frage, wie sehr politische Richtungsentscheidungen mit den Personen verbunden sind, welche sie vertreten. Unterscheiden lassen sich drei Dimensionen: a) die Personalisierung der Wahlkampfführung, b) die Personalisierung der Medienberichterstattung und c) die Personalisierung der Wahlentscheidung.
Wenn wir uns die Entwicklung der drei Dimensionen im internationalen Vergleich anschauen, lässt sich feststellen, dass die Personalisierung der Wahlkampfführung kein neues Phänomen ist, im Gegenteil: Parteien haben ihren Wahlkampf schon immer auf den Spitzenkandidaten ausgerichtet, die Dramaturgie der Wahlkämpfe, die „Drehbücher“, hatten schon immer einen Hauptdarsteller. Anders gelagert ist die Personalisierung der Medienberichterstattung. Hier lassen sich klare Veränderungen im Zeitverlauf festmachen: Mit dem Einzug des Fernsehens hielten nicht nur neue Formate wie z.B. TV-Duelle, Talkrunden etc. Einzug in das Politische – auch die Konzentration der Medien auf Personen nahm zu. Zwar sind nicht immer ausschließlich die Spitzenkandidaten im Fokus, aber Politiker per se stehen mehr und mehr im Rampenlicht.
Und nun kommen wir zur dritten Dimension, der Personalisierung des Wählerverhaltens. Diese lässt sich wiederum differenzieren in politische und unpolitische Eigenschaften – oder auch: rollennahe und rollenferne Eigenschaften – eines Kandidaten. Mit letzteren sind persönliche Integrität, physische Attraktivität und das Privatleben gemeint. Grundsätzlich festzuhalten ist, dass diese Eigenschaften eine immer wichtigere Rolle spielen: Bürgerinnen und Bürger richten ihre Wahlentscheidung mehr und mehr an den Kandidaten als an Parteien aus. Das Phänomen des personalisierten Wählerverhaltens ist uns aus präsidentiellen Systemen wohlbekannt, im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf etwa ist der Faktor Persönlichkeit schon lange ein Kernelement, dass strategisch genutzt wird: Die Frage, ob ein Kandidat „präsidiabel“ ist, ist für die Wähler zentral, und Wahlkampfstrategen setzen scheinbar unpolitische Eigenschaften aus dem Privatleben der Kandidaten ebenso in Szene, wie ihre Familienmitglieder oder persönlichen Freunde. Vergleichsweise neu ist, dass solche Entwicklungen auch in der Parteiendemokratie erkennbar sind. Allerdings zeigt die empirische Forschung deutlich, dass auch dort, wo Parteien und nicht Personen gewählt werden, Wahlentscheidungen vermehrt an der Person des Spitzenkandidaten ausgerichtet werden.
Und es sind vor allem die unpolitischen, rollenfernen Eigenschaften, die dabei ins Gewicht fallen. Die Logik, der dieses Phänomen zugeschrieben wird, überzeugt: Politische Inhalte werden immer komplexer und Bürger haben immer weniger Zeit, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Daher wählen sie sogenannte „kognitive Abkürzungen“. Sie leiten aus den unpolitischen Eigenschaften, über die sie sich schnell ein Urteil bilden können, ihre Einschätzung über die Kandidaten ab. Hier weist sich vor allem die Integrität der Kandidaten als wichtiger gegenüber den anderen unpolitischen Eigenschaften aus.
Was bedeutet dies nun für unsere Debatte um den Bundespräsidenten? Natürlich, er wird nicht direkt gewählt – dennoch wird er aber als prominenter Vertreter des Volkes wahrgenommen. Seine Autorität und seine Daseinsberechtigung in unserem politischen System sind in erster Linie darauf begründet, dass hier jemand jenseits der Grenzen der Parteienpolitik mit Vernunft, Moral und Augenmaß auf die politischen Entwicklungen im Land blickt, positive Entwicklungen fördert und negative offen anspricht. Dadurch wird dieses Amt zu demjenigen, welches am allerstärksten auf unpolitischen Eigenschaften beruht. Wenn diese nun aber schwinden, da die Integrität des Bundespräsidenten in Frage steht, liegt gemäß den Ergebnissen der Sozialforschung nahe, dass der Rückhalt in der Bevölkerung rapide sinken wird. Viel mehr noch, als wenn es sich um einen Minister oder Parteivorsitzenden handeln würde, für den sich eine gewisse durch Tricks und Kniffe unter Beweis gestellte Cleverness sogar positiv auswirken könnte. Man könnte auch sagen: Auf kein Amt wirkt sich ein Skandal potenziell so schädigend aus, wie auf das des Bundespräsidenten.
Literaturhinweise:
Aarts, Cees/Blais, André/Schmitt, Hermann (Hrsg.) ( 2011): Political Leaders and Democratic Elections. Oxford: OUP.
Klein, Markus/Ohr, Dieter (2000): Gerhard oder Helmut? Unpolitische Kandidateneigenschaften und ihr Einfluss auf die Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl 1998, in: PVS 41, 2, 199-224.