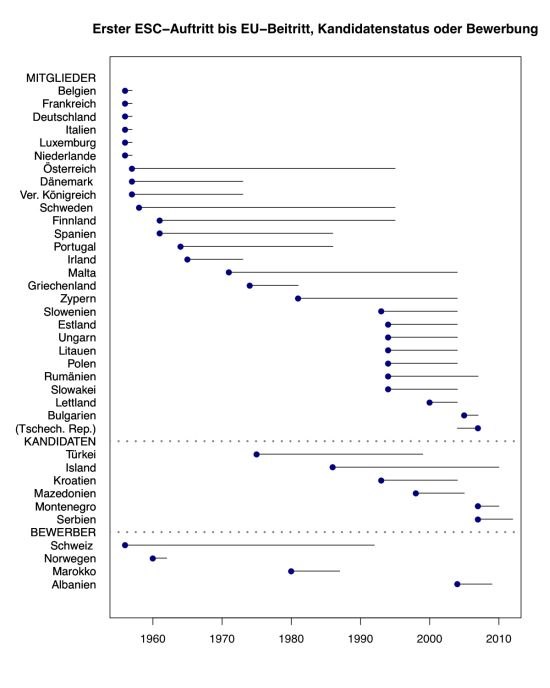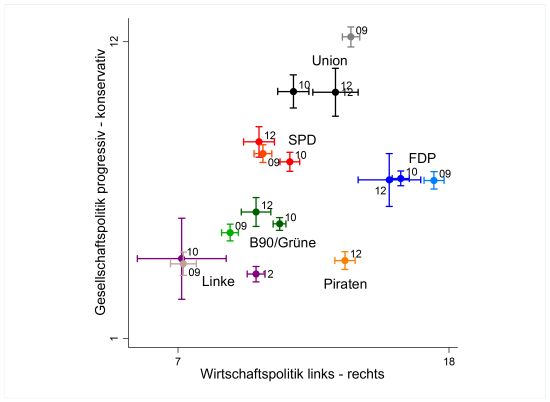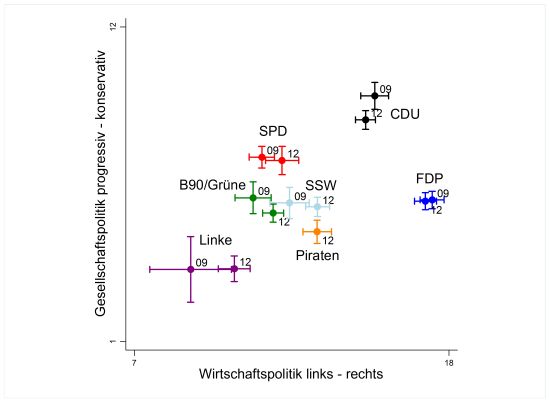Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin ein großer Fan von Norbert Lammert und mag seinen Witz, seinen Stil, seine Gesprächsführung – nicht zuletzt haben wir dasselbe Fach studiert. Sein aktueller Rundumschlag zur Rolle von Experten in der Politik – festgemacht an der Kritik der Ökonomen am Euro-Krisenmanagement der Bundesregierung – lässt sich im Zusammenhang mit dem aktuellen Anlass nachvollziehen. Jedoch schießt Lammert nicht nur übers Ziel hinaus, sondern setzt auch das Verhältnis von Politik und Beratung in das falsche Licht.
Schon der amerikanische Präsident Harry Truman fragte einst nach einem „one-handed economist“ – von ihm ist der verzweifelte Aufruf überliefert: „Gebt mir einen einhändigen Ökonomen, alle meine ökonomischen Berater sagen: auf der einen Seite, auf der anderen Seite… [Give me a one-handed economist; all my economists say on the one hand, on the other…]“. Dieser one-handed economist soll klare Ratschläge geben, die idealerweise auf Mehrheitsmeinungen beruhen und, wenn sie dann umgesetzt sind, zu einem wunderbaren Resultat führen.
Dies steht allerdings im klaren Wiederspruch zum Grundverständnis von Wissenschaft; hier kann jeder sagen und publizieren, was er möchte: Der öffentliche bzw. medial vermittelte Mainstream sowie vermeintliche „political correctness“ (also die Berücksichtigung von sogenannten politischen Notwendigkeiten in der wissenschaftlichen Analyse) sollten keine Rolle spielen. Nimmt man dieses Credo jedoch ernst, so darf man sich nicht wundern, wenn seitens der Wissenschaft mitunter harte und auch nicht ausschließlich konstruktive Kritik geübt wird. Sie folgt schließlich ihren ganz eigenen Maßstäben und orientiert sich nicht immer an der politischen Realität. Diese Diskrepanz hat der Journalist und Wissenschaftler Thomas Leif in einem Plädoyer folgendermaßen zusammengefasst: „Hier treffen zwei Welten aufeinander, die sich im Kern wenig zu sagen haben, weil sie sich zwei entgegengesetzten verschiedenen Handlungssystemen verpflichtet fühlen.“
In der Politik ist die Währung Macht, in der Wissenschaft ist es die Erkenntnis. In der Politik müssen Ergebnisse schnell erzielt werden und umsetzbar sein; in der Wissenschaft ist Schnelligkeit keine entscheidende Kategorie und die Analyse muss in erster Linie möglichst objektiv sein und alle relevanten Aspekte berücksichtigen, die Frage der Umsetzbarkeit ist zweitrangig.
So viel zu den Idealen, denen Wissenschaft und Politik folgen – und die dazu führen, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den beiden oft schwerfallen. Dabei können beide Systeme sehr voneinander profitieren: Politik braucht mehr denn je die (wissenschaftliche) Beratung. In einer Welt, die gekennzeichnet ist von einer rapide zunehmenden Komplexität, von einer rasant fortschreitenden Globalisierung, Internationalisierung und Europäisierung sowie von technischen und technologischen Entwicklungen, die unbekannte Chancen und Risiken mit sich bringen, sind Regierungen oder Parteien oder gar einzelne Politiker kaum in der Lage, alles relevante Wissen zu einem bestimmten Sachverhalt selbst zu erarbeiten. Diese Entwicklung erfordert spezialisierte wissenschaftliche Expertise, die deutlich über das z.B. in Ministerialverwaltungen vorhandene Know-how hinausgeht – insbesondere, wenn man den gleichzeitig stattfindenden und anhaltenden Stellenabbau in den Ministerien berücksichtigt.
Die Wissenschaft auf der anderen Seite würde sehr von einem stärkeren Praxisbezug, von einem Blick hinter die Kulissen profitieren. Dies würde der Frage der Anwendbarkeit von Forschungsergebnissen mehr Gewicht verleihen sowie das grundsätzliche Verständnis für die Situation der Politik und die damit verbundenen Restriktionen verstärken. Davon wiederum könnte auch die Hochschullehre profitieren. Gerade in Studiengängen, deren Absolventen politische Karrieren als attraktiv erachten, ist ein intensiver Austausch zwischen Politik und Wissenschaft explizit erwünscht.
Dafür, wie dieser Kontakt aussehen kann, gibt es keine Patentlösungen. An vielen Stellen findet Austausch statt, allerdings wird allseits noch immer ein Mangel an Verständnis des Gegenüber für die eigene Situation beklagt. So ist die Beschwerde zu deuten, die Norbert Lammert mit recht drastischen Worten vorgebracht hat. So ist aber auch die Frustration der Wissenschaft zu deuten, oftmals kein Gehör zu finden und lediglich als Feigenblatt für politisch ausgehandelte Entscheidungen zu dienen. Daher möchte ich abschließend an beide Seiten einige Denkanstöße richten.
An die Politik: wissenschaftliche Politikberatung darf nicht als Produkt verstanden werden, das auf Knopfdruck schnell abzurufen ist – „Quick fix“-Lösungen sind nicht die Stärke der Wissenschaft. Wissenschaftliche Politikberatung kann dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn sie als Prozess verstanden wird, d.h. dauerhaft in die politische Lösungssuche eingebunden ist.
An die Berater: Der Blick aus dem Elfenbeinturm heraus kann sehr erfrischend sein. Die Wissenschaft sollte sich der Politik stärker öffnen, auch wenn diese mitunter Forderungen stellt, die kaum zu erfüllen sind. Natürlich gibt es immer Pro und Kontra und gewisse Sachverhalte lassen sich einfach nicht auf nur einer A4-Seite hinreichend detailliert darstellen. Aber allein beim Versuch, der politischen Logik zu entsprechen, lernt man viel über die Politik, die eigene Disziplin und sich selbst.
Wenn es ab und an mal Wissenschaftler gibt, welche bereit sind, sich dieser Logik anzupassen, genießen diese Personen oftmals besondere Aufmerksamkeit. Der amerikanische Nobelpreisträger Paul Krugman wird seit Jahren explizit als „one-handed economist“ gefeiert – und kritisiert. Die deutschen Ökonomen mögen herausgehobene Stellungen in der Bearbeitung von Grundsatzfragen einnehmen (siehe z.B. Sachverständigenrat oder die Gemeinschaftsdiagnose), mit tagespolitischen Äußerungen sind sie jedoch im Allgemeinen vorsichtiger. Folgerichtig verursachte die Ausnahme von der Regel – der Offene Brief der 160 – so großen Wirbel.
Er ist eine Seltenheit und doch auch ein Zeichen dafür, dass die Wissenschaft in Deutschland zunehmend das versucht, was für beide Seiten notwendig ist: mit der Politik in Kontakt zu treten, mit ihr zu streiten und voneinander zu lernen.