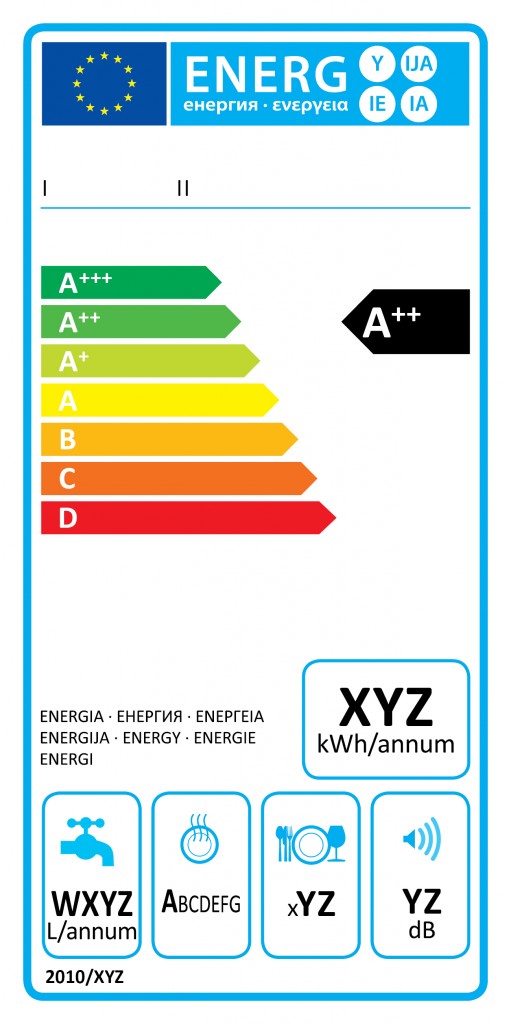Auf den ersten Blick klingen die Ziele ambitioniert: Die großen Elektronikkonzerne in den USA, etwa Panasonic, Sony und Toshiba, wollen in den kommenden fünf Jahren ihre Recyclingquote von Elektroschrott verdreifachen. Eine Milliarde US-Pfund Elektroschrott („one billion pounds“) wollen sie jährlich einsammeln, gaben sie jüngst bekannt. Das entspreche etwa einem Football-Stadium mit 71.000 Sitzplätzen, das bis zur Oberkannte nur mit alten Computern, Laptops, Handys und Fernsehern gefüllt sei. Ziel sei unter anderem zu verhindern, dass Elektroschrott unsortiert in Entwicklungsländern lande, wo er nicht nur für Umweltprobleme sorgt, sondern auch massive Gesundheitsschäden verursacht. Die eCycling Leadership Initiative will dafür unter anderem die 5000 Recyclinghöfe in den USA besser bewerben und setzt auf Aufklärung beim Kauf von neuen Elektrogeräten.
Doch Kritik gab es prompt – und zwar von prominenter Stelle. Das Basel Action Network, eine einflussreiche Umweltschutzorganisation, die sich auf illegale Müllexporte spezialisiert hat, weist darauf hin, dass die USA immer noch nicht die Basel Konvention ratifiziert haben. Das wäre der erste und wichtige Schritt, um den Export von Elektroschrott in Entwicklungsländer zu brandmarken. Dieses Abkommen regelt den internationalen Handel mit Giftmüll und verbietet den Export in Entwicklungsländer. Deutschland hat es 2002 ratifiziert.
So schön freiwillige Initiativen der Privatwirtschaft auch sein mögen, die Praxis zeigt: Beim Elektroschrott braucht es Gesetze, damit der Handel besser kontrolliert werden kann. Das findet auch die Electronics Take Back Coalition, die vermutet, die Unternehmen wollten einer ungeliebten Gesetzgebung nur zuvorkommen. Das Problem wird sicherlich nicht kleiner, nur weil niemand mehr darüber berichtet. Kaum eine andere Müllart wächst so schnell wie Elektroschrott (kein Wunder, wenn fast jedes Jahr neue iPhones auf den Markt kommen). Und die USA sind einer der größten Elektroschrott-Produzenten der Welt.