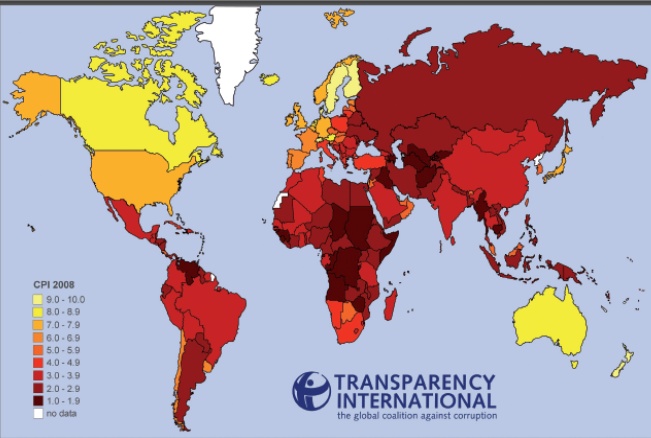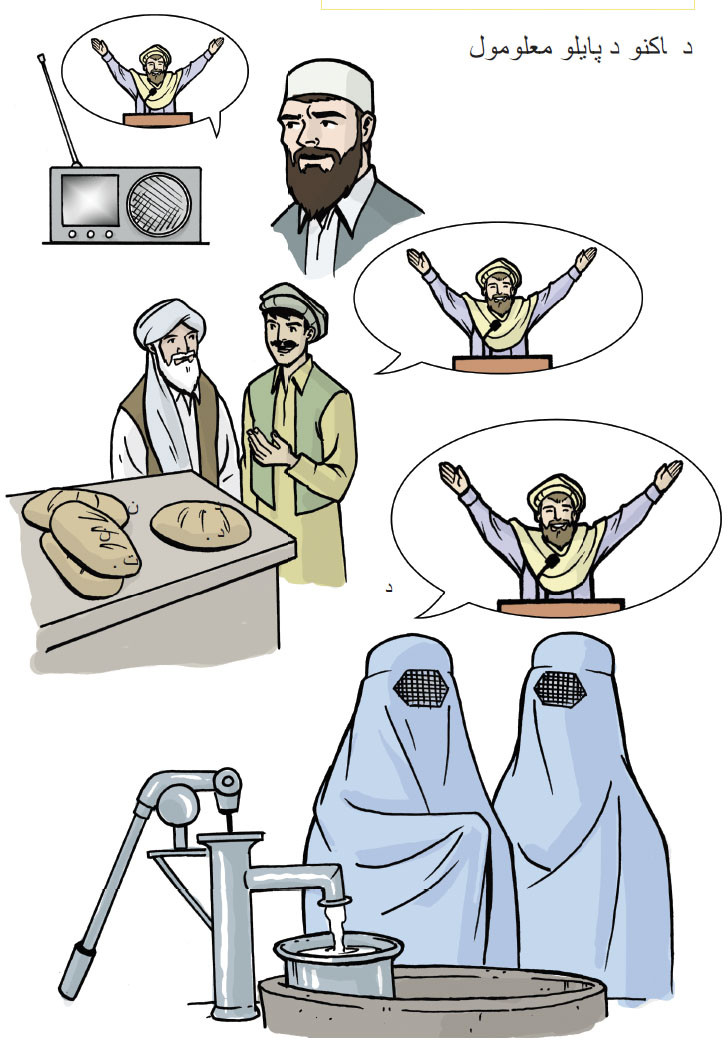Fragt sich die Vorsitzende der säschsischen Landtagsfraktion der Grünen, Antje Hermenau, in einem bedenkenswerten Stück (ebenfalls in der heutigen taz).
Die DDR-Tradition der Abschottung von Einwanderern hat ein unheilvolles Erbe hinterlassen, meint sie. Und man muss die Grünen wirklich dafür leiben, dass sie solche Fragen stellen, denen sich alle anderen gerne verweigern wollen: Hat die Fremdenfeindlichkeit im Osten etwas mit dem sozialistischen Staat zu tun?
Als 1989 die Mauer fiel, lebten etwa 192.000 Ausländer in der damaligen DDR. Viele von ihnen waren Arbeitsmigranten, in der DDR ‚Vertragsarbeiter‘ genannt. Sie waren über staatliche Abkommen ins Land gekommen. Das SED-Regime achtete streng darauf, dass sie nach der vereinbarten Zeit wieder in ihre Heimatländer zurückkehrten. Während sie in der DDR lebten, wohnten sie abgeschottet in Heimen, über die Einzelheiten der Abkommen mit ihren Herkunftsländern war bei der Bevölkerung wenig bekannt.
Ein Miteinander zwischen einheimischer und eingewanderter Bevölkerung, das über demonstrative Gastfreundschaft hinausging, war nicht vorgesehen. Bestehende Ressentiments und fremdenfeindliche Übergriffe, die es sehr wohl gab, wurden tabuisiert und geheim gehalten. Im Gegensatz zur Bundesrepublik gab es keine Normalisierungsprozesse zwischen Eingeborenen und Eingewanderten.
Dieses Erbe der Vergangenheit ist auch heute noch in Ostdeutschland gegenwärtig. Auch 20 Jahre nach der Wende gibt es ausreichend Anzeichen, dass die Vorstellung, Migrantinnen und Migranten seien nicht Teil dieser Gesellschaft, sondern eine Gruppe von ‚Besuchern‘ auch weiterhin verbreitet ist.(…)
Was in Sachsen und Ostdeutschland fehlt, ist eine aktive Auseinandersetzung mit dem DDR-Erbe sowie eine realistische Analyse zur Situation der Einwanderer in Ostdeutschland.
Die Ausschreitungen in Hoyerswerda 1991, der Tod von Jorge Gomondai in Dresden 1991 oder aber auch die Übergriffe in Rostock-Lichtenhagen 1993 hätten Anlass sein müssen, eine eigene ostdeutsche Debatte zu Zuwanderung, Fremdenfeindlichkeit und den Umgang mit Migrantinnen und Migranten in breite gesellschaftliche Schichten zu tragen.
(…)
Auch die politisch Verantwortlichen tragen zu einem Zerrbild bei, wenn sie in Veranstaltungen über den Islam hauptsächlich über die Gefahr von Terrorismus reden, statt über in Ostdeutschland tatsächlich bestehende Herausforderungen und Probleme von Menschen mit Migrationshintergrund zu diskutieren.
Der Mord an Marwa el-Sherbini hat auch etwas anderes deutlich gezeigt: Dass diese Frau hervorragend gebildet war, Deutsch sprach und das deutsche Rechtssystem nicht nur anerkannte, sondern sich ihm sogar anvertraute, hat sie nicht vor der schrecklichen Gewalttat bewahrt. Auch wenn sie schon bald nach Ägypten zurückkehren wollte, entsprach sie fast dem konservativen Wunschbild der „Integration“. Das hat sie nicht geschützt. Wir müssen uns also die Frage stellen, ob wir in Sachsen den Menschen, die von vielen als „Fremde“ wahrgenommen werden, den Respekt entgegenbringen, auf den jeder, wirklich jeder Mensch Anspruch haben muss – unabhängig von Herkunft oder Religionszugehörigkeit.