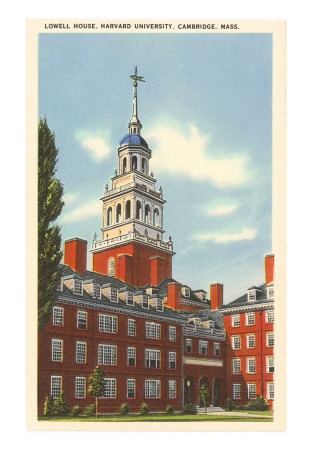An der Kennedy School of Government sprach heute Alex Castellanos, der für seine Schmutzkampagnen berüchtigte republikanische Kampagnen-Manager.
Seine „Study Group“, die sich noch bis nach der Wahl jede Woche versammeln wird, ist völlig überlaufen.
Castellanos ist ein witziger, charismatischer Mann um die Fünfzig. Zu Beginn geht eine Schüssel mit Süßkram herum, aus dem die Studenten sich bedienen.
„Ich bin ein konservativer Republikaner, das sage ich lieber gleich, und aus dieser Warte spreche ich hier“, schickt Castellanos vorweg. Er fragt: Wer hier wird in diesem Jahr zum ersten Mal wählen? Eine Mehrheit.
Wer hat schon einmal republikanisch gewählt? Ein einzelner meldet sich schüchtern. „Das können wir in diesen Hallen als Diversität durchgehen lassen!“
Allgemeines Gelächter, Castellanos hat die Leute auf seiner Seite. „Okay, dann wollen wir mal drüber reden, wie man zynisch die öffentliche Meinung manipuliert.“ Wieder Gelächter.
Castellanos hatte im letzten Wahlkampf 100 Millionen Dollar zur Verfügung, um Kerry zu erledigen. Was er dann ja auch, mit Kerrys Beihilfe, geschafft hat. Der demokratische Bewerber wurde als „soft on defense“ fertiggemacht, der Vietnam-Veteranen-Statur zählte nicht (nachdem gewisse Freischärlergruppen ihn mit den „Swift-Boat-ads“ angegriffen hatten).
In dieser Saison hatte der gewiefte PR-Mann auf Mitt Romney gesetzt, der jedoch in den Primaries unterlag.
Castellanos erstes Beispiel für einen guten TV-Clip ist Obamas Spot, in dem er sich als ein Junge aus Kansas darstellt, mit amerikanischen Werten – „values from the heartland“ -, die ihm seinen Weg erst ermöglicht hätten. „Das ist nicht der typische demokratische Kandidat, der da spricht. Den hätte man vor Jahren für einen verrückten Rechten gehalten, so positiv wie der sich auf Amerika bezieht!“
McCains Leute hatten lange Schwierigkeiten, dem etwas entgegenzusetzen, meint Castellanos. Erst durch den Auftritt Obamas in Berlin seien sie so richtig aufgewacht. Indem sie Obama als eine x-beliebige Celebrity wie Britney Spears abtaten, fanden sie zurück zu ihrem Angriffsschwung.
„Das half zwar erst mal bei den Umfragen. Das Problem jedoch blieb, daß man den Leuten zwar sagen konnte, warum man Obama nicht wählen könne. Aber McCain selbst hatte keine Message.“
Castellanos ist ein begnadeter und rücksichtloser Meister der Attack-Ad. Einmal berüchtigter Weise bis zu rassistischen Untertönen – „Du brauchtest den Job. Aber sie gaben ihn einem aus einer Minderheit…“. (Hier eine Geschichte in Salon dazu.) Doch er glaubt erklärtermaßen nicht an „Spin“. In einer Welt mir „zuviel Information“ sei es hoffnungslos, Sachen zu erfinden und zu glauben, die würden sich schon irgendwie festsetzen.
Es gehe nicht um „how to spin“, sondern um „how to lead“. Präsidenten sind für Castellanos einerseits „leitende Marken“ (ruler brands), andererseits aber im besten Fall auch“verwandelnde Marken“ (transformational brands). In Amerika wollen wir einen Präsidenten, sagt Castellanos, „der uns an einen besseren Ort führ, jenseits des Horizonts.
Auf seinem persönlichen Mount Rushmore des letzten Jahrhunderts würden sich darum Roosevelt, JFK, Reagan und Clinton wiederfinden. „Auf eine gewisse Weise sind sie alle derselbe Typ“, meint Castellanos – alle ebenso leitend wie transformierend.
Ich kam leider nicht dazu, ihn zu fragen, warum er George W. Bush weggelassen hat, der nicht zuletzt ihm seine zweite Amtszeit verdankt. Wahrlich ein transformierender Präsident! Aber das hätte womöglich die Stimmung etwas verdorben.
An Obamas Kampagne findet Castellanos sehr professionell, dass sie viel mehr anbietet als bloss „issues“. Wer die Website aufruft, wird angesprochen, er solle nicht nur an die Fähigkeiten des Kandidaten glauben, Wandel zu bringen, sondern an sich selbst. „Wow. Das ist keine Kampagne mehr – das ist eine Bewegung!“ Damit wird die Wahl umdefiniert von einem Wettbewerb zwischen McCain und Obama zu einem zwischen McCain und Dir. Auf Dich kommt es an, Wähler.
Castellanos glaubt, dass die Demokraten keine andere Wahl hatten, als auf Change zu setzen: Wenn eine überwältigende Mehrheitim Land denkt, das Land sei auf dem falschen Kurs, dann geht es in der Wahl um Wechsel und Wandel. Ob die Demokraten aber nicht ein bisschen übermütig waren, in die Wechselstimmung hinein auch noch einen sichtlich andersartigen Kandidaten zu schicken, derim amerikanischen Sinne „links“ is, einen komischen Namen hat u n d überhaupt keine Regierungserfahrung?
Vielleicht ist das in einer turbulenten Lage wie dieser am Ende zu viel Change.
McCain, so Castellanos, hat nun die Strategie, Obama auf dem Feld des Wandels so viele Stimmen streitig zu machen, dass er ihn schließlich auf dem Feld Erfahrung schlagen kann. Umgekehrt versucht Obama in Sachen Erfahrung so viel Boden gut zu machen, daß schließlich das Moment des Wandels für ihn ausschlaggebend wird. Das ist das Spiel der nächsten Wochen.
Zwei große Faktoren sieht Castellanos als entscheidend an: Frauen als Wähler. Und die Wirtschaft. 77 Prozent der Konsumentenmacht ist in den Händen der Frauen. Sie bestimmen über die Budgets. Sie sind sehr viel schwerer zu fassen, als die Männer mit ihren klassischen Milieus.
Und die neue Krisenlage hat es zu einem verteufelt schweren Ding gemacht, gegen Washington zu kandidieren, wie es ja beide Kandidaten für sich beanspruchen: Nie gab es mehr Mißtrauen gegenüber Washington, und nie mehr Wunsch nach Führung zugleich.
Wer dieses Paradox auflösen kann, wird der nächste Präsident. (Glaube ich jedenfalls.)