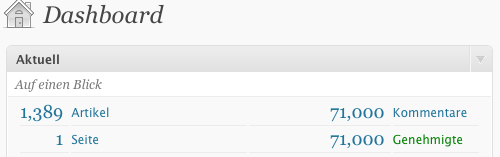„Noch niemals wurde die Meinungsfreiheit in Ägypten so eingeschränkt.“ „In unseren Ländern gibt es nach der Arabischen Revolution eine absolute Freiheit der Presse.“
Die letzten drei Tage habe ich in Barcelona verbracht, bei einem Treffen mit arabischen Journalisten, Bloggern, Menschenrechtlern (gefördert von der Mittelmeer-Union und der Anna-Lindh-Stifung). Zwischen den beiden oben genannten Sätzen oszillierte die Selbstdarstellung der Kollegen. Wahrscheinlich stimmt beides.
Frustration, Wut und Erschöpfung konnte man aufseiten der Aktivisten erleben. Lina Ben Mhenni, die mit ihrem Blog „A Tunisian Girl“ maßgeblich am Beginn der Revolte beteiligt war, wirkte extrem desillusioniert und ausgepowert. Sie sprach von zunehmenden Attacken, auch von physischen Bedrohungen gegen selbstbewusste, freiheitsliebende Blogger wie sie. Ganz offensichtlich hat die Ermordung Belaids sie mitgenommen.
Hani Shukrallah aus Kairo, eine der wichtigsten säkularen Stimmen der ägyptischen Debatte, berichtete von Hetze in salafistischen und MB-nahen Medien gegen ihn und andere Liberale. Es seien unter Mursi mittlerweile mehr Journalisten und Blogger wegen „Beleidigung des Präsidenten“ belangt worden als unter Mubarak. Rasha Abdullah, die an der Uni Kairo über Journalismus forscht, sprach ebenfalls davon, die Meinungsfreiheit sei „auf dem Rückzug“ in Ägypten. Zwar seien die Bürger heute schwerer einzuschüchtern als vorher und lehnten sich gegen die Autoritäten auf, aber der Preis dafür sei hoch, und dies sei eben nicht mit Pressefreiheit zu verwechseln.
Der aus Tunesien stammende Journalist Noureddine Fridhi (für Al-Arabya in Brüssel) sagte, es gebe in Tunesien keine staatliche Zensur und somit eine beispiellose Pressefreiheit. Doch sei die Medienlandschaft extrem polarisiert und tendenziös. Unternehmer und politische Kräfte unterhalten Medien als Propagandamittel zur Beförderung ihrer jeweiligen Agenda. der so entstehende Pluralismus sei extrem verwirrend für das Publikum, weil die immer gleichen Positionen auf einander treffen.
Um ein realistisches Bild von der Lage im Land zu bekommen, sei man auf ausländische Medien angewiesen (was wiederum vor allem Eliten nutzen können). Das bestätigte die Leiterin der Auslandsprogramme von France 24, Karin Osswald: Frankreichs internationaler Sender ist heute in Tunesien die Nummer Eins, vor Al Jazeera und Al Arabya – auch eine erstaunliche Ironie.
Der Kollege Lotfi Hajji von Al Jazeera in Tunesien, der zusammen mit Noureddine Fridhi auf meinem Podium saß, erging sich lange in Anschuldigungen gegenüber dem Westen, der „den Islam“ falsch darstelle. Selbst wenn dem (immer noch?) so wäre (was ich bestreiten möchte), muss man fragen: Ist das Tunesiens Problem? Fridhi hingegen beschuldigte Al Jazeera, „der Sender des Islamisten“ zu sein, jedenfalls werde das in der tunesischen Gesellschaft so wahrgenommen. Hajji schüttelte zwar den Kopf, wich aber aus, er sei kein Sprecher und dürfe sich zur Redaktionspolitik nicht äußern.
Die beiden entscheidenden Networks der arabischen Welt haben unterschiedliche Rote Linien: Al Jazeera kann nicht über katarische Interessen in der Region berichten, über die Politik des Emirs, überall die Muslimbrüder und ihre Ableger an die Macht zu bringen – es ist ja ein Instrument dieses Kampfes. Al Arabya blendet saudische Interessen aus, und infolge dessen etwa die Niederschlagung des Aufstands in Bahrein.
Immerhin wurde dies in Barcelona angesprochen, von einer super mutigen jungen syrisch-polnischen (!) Kollegin namens Rima Marrouch. Es war ein bisschen erschütternd zu sehen, wie die beiden etablierten Kollegen von den mächtigen arabischen TV-Sendern einfach passen mussten, als Rima sie fragte, warum Al Jazeera nichts über die Exzesse der Islamisten (auch in Syrien) berichtet und Al Arabya nichts über den Hintergrund des Aufstands in Bahrain.
Trotz aller Rückschläge vermittelten die Kollegen – sehr viele unter ihnen übrigens Frauen – den Eindruck, dass sie nicht klein beigeben werden. Hani Shukrallah wurde auf Druck der Muslimbrüder in eine frühere Pensionierung gedrängt. Seine Leitung des Internetauftritts des staatlichen Al Ahram Medienkonzerns war offenbar zu unabhängig. Er ist zuversichtlich, dass er seinen Job in die Hände von leuten übergeben kann, die ebenso aufmüpfig sind wie er selbst.
Die freiheitsliebenden arabischen Blogger und Journalisten richten sich auf einen langen Kampf ein.