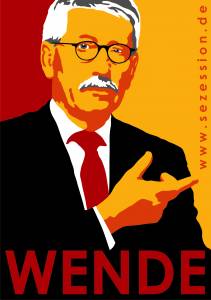Mitbloggerin Miriam fasst die Debatte über Integration und Islam folgendermaßen zusammen:
„Aus meiner Sicht führt primär die Kollision von traditionellen und modernen Werten zu der Problematik, die wir hier diskutieren. Zum Beispiel:
1. Individualismus versus Kollektivismus bzw. Familialismus
2. Gleichberechtigung der Geschlechter versus Gleichwertigkeit und Komplementarität
3. Unterwerfung unter den Willen Gottes bzw. Älteren/Eltern versus Verhandlung. (Das mag im Zusammenhang mit Gott paradox klingen. Aber dadurch, dass der Gott der Christen ein Gott-Vater ist, ändert sich die Beziehung zu diesem “Vater” in dem Maße, wie die Beziehung zu irdischen Vätern sich ändert.) Man bezeichnet moderne Familien als “Verhandlungshaushalte” und traditionelle Familien als “Befehlshaushalte”. Verhandlungshaushalte fördern und fordern Individuierung im Sinne der Entwicklung einer autonomen Persönlichkeitsstruktur, und sie betreiben Individualisierung im Sinne der Freisetzung des Einzelnen aus der Umklammerung des Kollektivs. Eben diese Freisetzung ist ein Kennzeichen der modernen Gesellschaft und ihre Abwesenheit ist ein Merkmal traditioneller Gemeinschaften.
4. “Reinheit” im Sinne von Jungfräulichkeit. Gesucht wird eine Frau, die “sauber” ist. Eine Frau, die vor der Ehe “berührt” wird, gilt als “dreckig. Das traditionelle Reinheitsgebot begünstigt die Endogamie, auch ein traditioneller Wert, und erschwert die Exogamie. Denn man will nicht die Katze im Sack kaufen, sondern wissen, mit wem (auch mit welcher Sippe) man es zu tun hat. Mit dem Reinheitsgebot im Zusammenhang steht die
5. “Ehre” (namus) als unantastbares Merkmal eines Kollektivs, das vom sexuellen Verhalten der weiblichen Mitglieder des Kollektivs abhängt. Die junge Frau, die vor der Ehe ihre Jungfräulichkeit verliert, verliert nicht nur die eigene Ehre, sondern entehrt die ganze Familie. Die Verantwortung, die man in dieser Hinsicht als Frau trägt, erschwert die Individuierung, denn dabei riskiert man das ganze Familiengebäude zum Einsturz zu bringen. Aber auch die Männer tragen eine Verantwortung, nämlich Fehltritte ihrer Schwestern, Frauen sogar ihrer Mütter zu verhindern. Das zwingt sie in die Rolle des Aufpassers und erschwert ihre Emanzipation von der traditionellen Pascha-Rolle. (Die traditionell erzogenen kurdischen Mädchen, die ich kenne, klagen am meisten über ihre Brüder, auch ihre jüngeren Brüder, die sie Paschas nennen und die ihnen vorschreiben möchten, wie sie zu leben haben.) Die traditionelle Vorstellung von Ehre prägt auch die Art und Weise, wie die deutsche Gesellschaft betrachtet wird, denn aus traditioneller Sicht sind die meisten Frauen ehrlos und die meisten Männer verdienen die Bezeichnung namussuz adam (ehrloser Mann), weil sie die Verwahrlosung ihrer Frauen nicht verhindern. Auch das erschwert die Integration.
Ich löse Integration von der ethnischen und religiösen Ebene und betrachte sie (auch) als Übergang von der Tradition in die Moderne, als Überwindung traditioneller und Übernahme moderner Werte. Das setzt weder das Leugnen der ethnischen Herkunft noch die Aufgabe der Herkunftsreligion voraus. Zwei prominente Frauen, die diesen Weg erfolgreich gegangen sind (und die es sogar schafften, ihre Eltern zumindest ein Stück weit mitzunehmen) sind Seyran Ates und Hatice Akyün. Sie zeichnen sich durch eine starke Ich-Identität im Sinne von Lothar Krappmann aus, d.h. es gelingt ihnen, Balance zu halten zwischen den Anforderungen der sozialen Umwelt und ihren eigenen Bedürfnissen. Diese Leistung ist um so bewundernswerter, wenn man bedenkt, dass sich diese Frauen mit den konfligierenden Anforderungen der traditionellen Herkunftsgruppe und der modernen deutschen Gesellschaft sich auseinandersetzen müssen.
Im folgenden Beitrag in der ZEIT blickt Ates auf ihre Kindheit in Istanbul und Berlin zurück und beschreibt ihre Vorstellung von Freiheit und Individuum sowie ihren Kampf um eine Balance zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und den Anforderungen ihrer türkischen Umwelt:
„Es dauerte nicht lange, bis ich begriff, warum ich solch ein Leben führte. Ich war ein Mädchen, ich stellte die Ehre der Familie dar, und mein Jungfernhäutchen, von dem ich lange nicht wusste, was das überhaupt ist, war von größerem Interesse für die Großfamiliengemeinschaft als mein Gehirn. Wenn ich mein Gehirn benutzte und meine Meinung äußerte – meist eine, die sich für ein türkisches Mädchen nicht schickte –, wurde ich für verrückt erklärt. Da war es wieder; wenn auch angeblich scherzhaft. In meiner näheren Umgebung wurde ich als die kluge Verrückte bezeichnet. Ich hatte nicht das Gefühl, verrückt zu sein. Aber irgendwie merkte ich schon, dass wir nicht so gut zusammenpassten: die türkische Kultur in Deutschland und ich. Meine gesamte Umgebung kontrollierte alle weiblichen Wesen auf Schritt und Tritt. Wobei ich leider sagen muss, dass nicht nur Männer dieses System aufrecht erhielten.
Ich wollte mich von dieser Enge befreien. Es war nicht die kleine Wohnung, das fehlende Kinderzimmer, sondern der Staub aus Anatolien, der mir die Luft zum Atmen nahm. Jeder Tag fing an mit dem Traum nach Freiheit und endete damit. Ich habe diesen Traum so lange geträumt, bis ich ihn für mich verwirklichen konnte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Dinge, die ich mir erträumt habe, tatsächlich in Erfüllung gegangen sind. Ich musste nur meinen Anteil dazu tun. Das habe ich von den Deutschen gelernt. Sie haben mir beigebracht, dass ich ein Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und eigene Meinung habe. Und sie haben mir beigebracht, dass alle Menschen gleich sind. Diese wunderbare Freiheit des Körpers und des Geistes steht allen Menschen zu.“