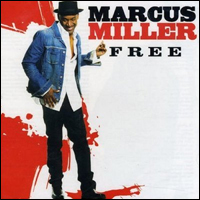
Natürlich kann man sich bei vielen Alben fragen, warum es sie überhaupt gibt. Was will uns diese Sängerin, jene Band mit ihrem Werk sagen? In der Regel finden sich Hörer, die diese Frage wenigstens für sich beantworten können. Solo-Alben von Schlagzeugern oder Bassisten verlangen nach besonderer Rechtfertigung. Gemeinhin gelten diese Musiker als Protagonisten der Begleitung, solistisches Auftrumpfen wird von ihnen nicht erwartet.
Marcus Miller ist Bassist, Miles Davis entdeckte ihn einst. Ihn scheren solche Vorurteile nicht. Seine CD Free ist rührend altmodisch geraten. Er nahm sich je eine Handvoll eigener und fremder Kompositionen und lud alte Freunde – den Saxofonisten David Sanborn, den Gitarristen Keb’ Mo’ – und neue Freundinnen wie die Soul-Sängerin Corinne Bailey Rae ins Studio ein. Er hatte dort das Sagen, die unterschiedlichen Bassgitarren, das Fender-Rhodes-Piano, die Hammond-Orgel und die Klarinette spielte er selbst. Im CD-Büchlein listet er die eingesetzten Instrumente penibel auf. Die elektrische Bassgitarre hält er für ein Solisten-Instrument wie die Gitarre und das Saxofon, sein Bassspiel verblüfft die Zuhörer mit Virtuosität und mitunter aberwitziger Geschwindigkeit.
Was soll man dagegen einwenden? Aus allen Ecken und Winkeln von Free slappt und poppt es. Marcus Miller wurde groß in einer Jazz-Szene, die vom Funk beeinflusst wurde. Es macht sogar Spaß, den Tricks des Saiten-Fexes zu folgen, immer wieder fragt man sich: Wie hat er das nun wieder gemacht?
Eines stört: Free ist ein Sammelsurium von Stilen. Es ist kein Jazz-Album, auch keine Pop-CD. Es will beides ein wenig sein, aber nicht so richtig. Seine eigenen Kompositionen – wenn man diese Ostinato-Abhandlungen so nennen will – basieren auf einem mehr oder weniger simplen Riff, das er durch Improvisationen variiert. Der eigentliche Bass bleibt im Hintergrund, mitunter wird er mit Hilfe eines Synthesizers erzeugt. Bei Pluck ist das so und bei Funk Joint. Das Stück Free hingegen ist ein veritabler R’n’B-Song, Corinne Bailey Rae singt sich unnachahmlich durch die Melismen. Aber stimmen hier Form und Inhalt? Kann man den Wunsch nach Freiheit
Den Gegenpol bietet Jean Pierre, eine Komposition von Miles Davis. Das Stück beginnt interessant, Marcus Miller spielt das unverwechselbare Thema auf seiner Bassgitarre, ein Wechselspiel von Bruchstücken des Themas zwischen tiefer und hoher Bassgitarre beginnt. In Rede und Gegenrede gibt es ein Improvisationsgeplänkel zwischen ihm und dem Mundharmonika-Spieler Gregoire Maret – das war es dann aber auch. Am Ende wird das Stück einfach ausgeblendet. Das anschließende Higher Ground von Stevie Wonder ist dann wieder konziser, es ist der Höhepunkt der CD.
Sicher, man staunt über Marcus Millers instrumentales Können, seinen rhythmischen Einfallsreichtum und seinen Sinn für Klanggestaltung. Doch man wünscht dem einen anderen Rahmen. Eine Band mit ähnlich kraftvollen Musikern, die ihm zeigen, dass ein Bassgitarrist durchaus auch einfach mal nur begleiten kann.
„Free“ von Marcus Miller ist erschienen bei Dreyfus Records/Soulfood Music.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie FUNK
Medeski Scofield Martin & Wood: „Out Louder“ (Emarcy/Universal 2007)
Nik Bärtsch: „Stoa“ (ECM 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik

