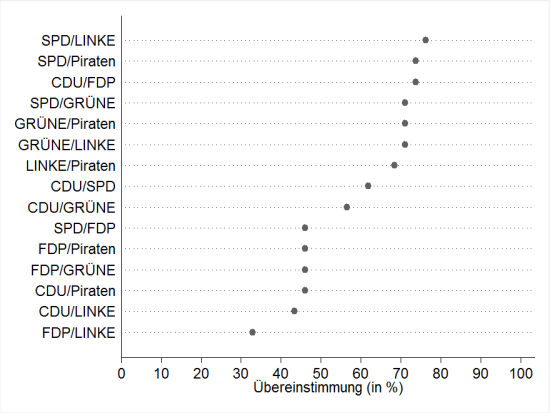von Thorsten Faas und Johannes Blumenberg
Die Zeiten von „Wir können alles – außer politische Veränderung“ sind in Baden-Württemberg längst Geschichte. Stuttgart21, Eskalation im Schlossgarten, Schlichtung, Stresstest, Fukushima, Moratorium, Landtagswahl, Volksabstimmung. Wer hätte gedacht, dass das „Ländle“ überhaupt in solch politisch-turbulentes und dynamisches Fahrwasser geraten kann. Heute vor einem Jahr jedenfalls, am 27. März 2011, fand die Landtagswahl statt. Am Ende des Wahlabends standen 71 Sitze für Grün-Rot im Stuttgarter Landtag, 67 für Schwarz-Gelb. Und kurz darauf hat eben dieser Landtag Winfried Kretschmann zum ersten grünen Ministerpäsident der bundesdeutschen Geschichte gewählt.
Seit November 2010 begleiten wir an der Universität Mannheim mit (Online-)Umfragen die politischen Entwicklungen im Südwesten Deutschlands. Inzwischen haben wir einen identischen Kreis von rund 1.000 Personen insgesamt neun Mal befragt. So können wir nachzeichnen, was in den letzten rund 18 Monaten politisch passiert ist. Und wie folgende Abbildung zeigt, ist Einiges passiert – gerade mit Blick auf die Grünen und ihren exponiertesten Vertreter, Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Entwicklung der Beliebtheitswerte (*)

Wir haben unsere erste Befragung, die wir Ende 2010 durchgeführt haben, als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung genommen. Wie haben sich die Beliebtheitswerte von Kretschmann und den Grünen relativ dazu entwickelt? Zunächst praktisch gar nicht: Zum Zeitpunkt unserer zweiten und dritten Befragung, rund fünf bzw. drei Wochen vor der Wahl vom 27. März 2011 haben sich beide Kurven kaum verändert. Doch schon in der letzten Woche vor der Wahl deutet sich an: Die Grünen sind „ready for take-off“ – und allen voran ihr Spitzenmann.
Nach dem Wahlsieg vom 27. März 2011 beschleunigen sich dann die beiden Prozesse, die sich auf der Zielgerade des Wahlkampfs schon angedeutet haben:
1) Die Kurven für Kretschmann und die Grünen steigen deutlich an.
2) Die Kurven entkoppeln sich.
Schon in der fünften Befragungsrunde, durchgeführt unmittelbar nach dem Wahltag, setzt ein, was Wahlforscher prosaisch den „Honeymoon“-Effekt nennen: Im Lichte des Wahlerfolgs sonnen sich die Sieger und gewinnen an Zuspruch. Die Grünen können einen halben Sympathiepunkt hinzugewinnen – Kretschmann einen ganzen. (*) Und sein Aufstieg geht in der Folge sogar noch weiter: Befragungsrunde 6, unmittelbar nach der Vereidigung der neuen Regierung, weist nochmals einen deutlichen Sympathiegewinn für den MP aus. Auch das Ansehen der Grünen steigt weiter – wenn auch deutlich bescheidener.
„Honeymoon is größtenteils over“ heißt es danach für die Grünen: In unseren Befragungswellen 7 und 8 – durchgeführt in den Wochen vor der Volksabstimmung zu Stuttgart21 – sinken ihre Beliebtheitswerte wieder und pendeln sich auf einem Niveau ein, das insgesamt etwas über dem Ausgangsniveau vom November 2010 liegt. Anders im Falle des Ministerpräsidenten: Seine Werte bleiben oben – knapp 1.5 Sympathiepunkte über dem Wert, mit dem er 2010 in den Wahlkampf gestartet ist.
Der Aufstieg Kretschmanns ist in Rasanz und Persistenz bemerkenswert. Nur zur Erinnerung: Wir haben immer den gleichen Personenkreis befragt! Es handelt sich folglich um realen Wandel – der wohl nur dadurch zu erklären ist, dass Kretschmann in kürzester Zeit die Rolle des Landesvaters erfolgreich eingenommen hat. Selbst das schwierige Umfeld rund um die Volksabstimmung und deren Umsetzung haben seiner gewachsenen Beliebtheit offenkundig nichts anhaben können. Er ist im Amt angekommen. Viele Kommentare, die dieser Tage aus Anlass des „Einjährigen“ geschrieben und gelesen werden, argumentieren ähnlich. Unsere Zahlen zeigen: Sie haben wohl recht.
Thorsten Faas (@thorstenfaas) ist Juniorprofessor für Politikwissenschaft, insbes. Wählerverhalten an der Universität Mannheim.
Johannes Blumenberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung der Universität Mannheim.
(*) Basis der Abbildung sind so genannte Symapthieskalometer. Die Politikerfrage lautet dabei: „Kommen wir nun zu einigen führenden Politikern in Baden-Württemberg. Einmal ganz allgemein gesprochen, was halten Sie von diesen Politikern? Benutzen Sie dafür bitte eine Skala von +5 bis -5. +5 bedeutet, dass Sie sehr viel von der Person halten; -5 bedeutet, dass Sie überhaupt nichts von ihr halten“; die Parteienfrage lautet analog. Wir haben die mittleren Bewertungen, die für die erste Befragung resultierten, dabei als Ankerpunkt verwendet und in der Grafik auf den Wert 0 gesetzt.