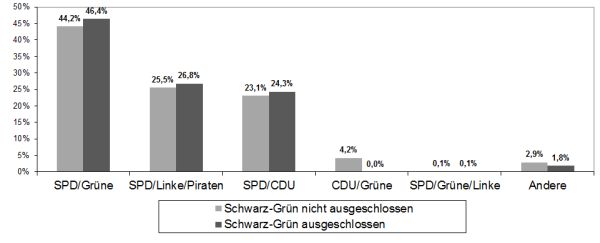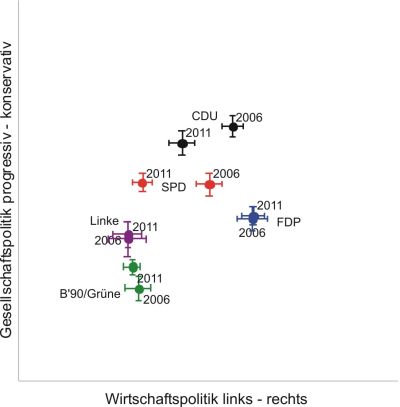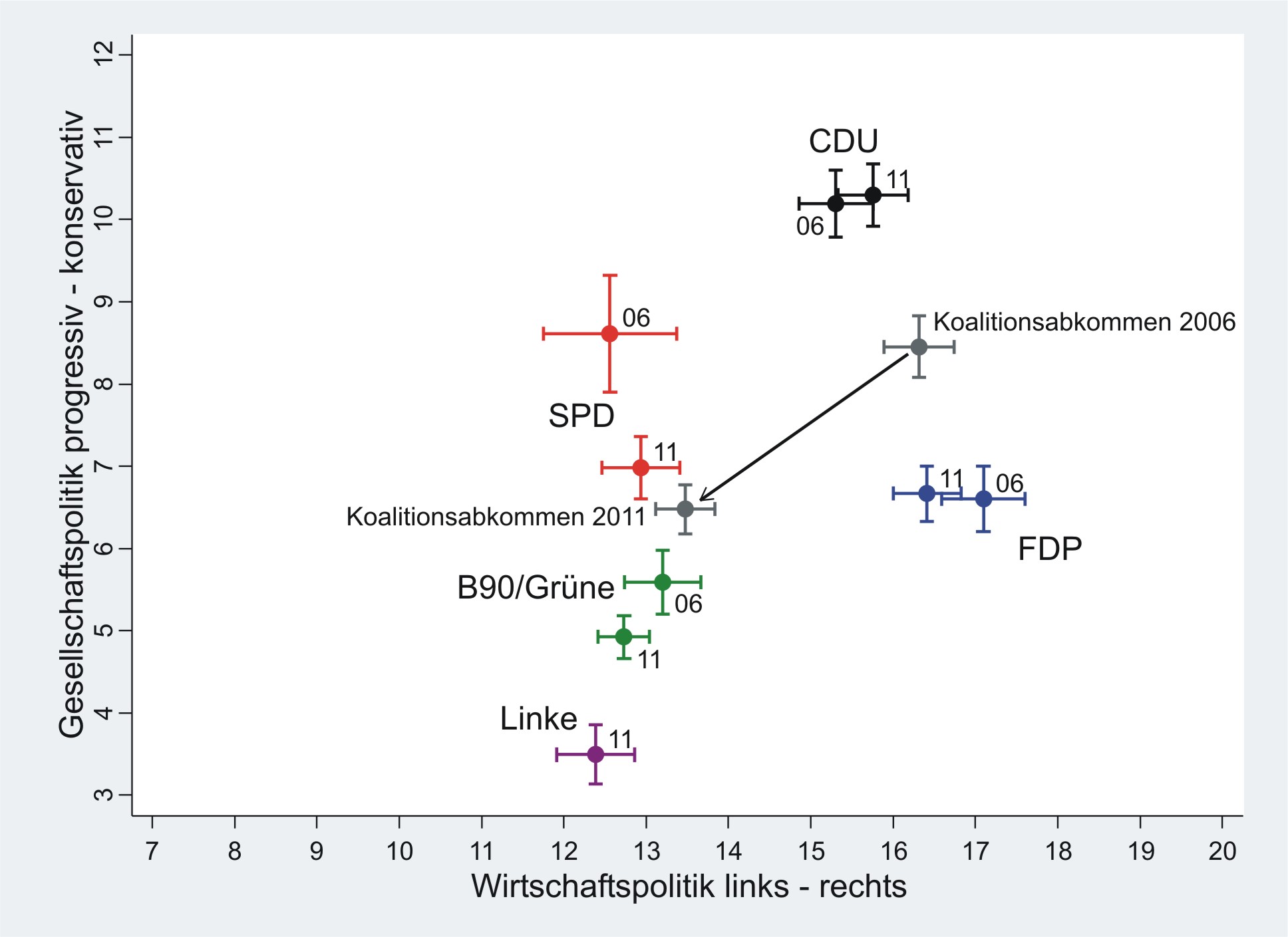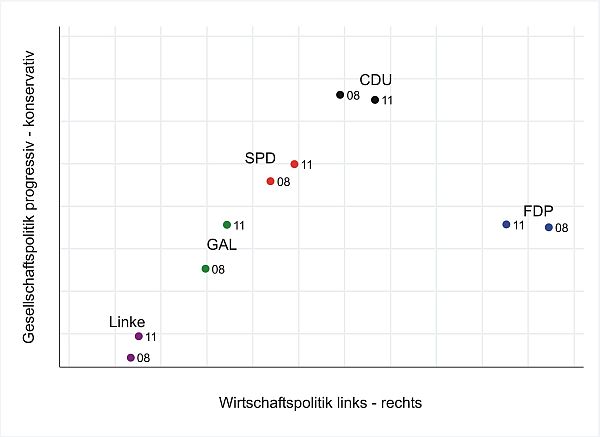100 Tage ist die große Koalition alt. 100 Tage, deren Fazit schnell gezogen ist. Nicht ohne Grund werden große Koalitionen in der Bundesrepublik gemeinhin eher argwöhnisch betrachtet. In der Bevölkerung werden sie oftmals als politische Notlösung empfunden und selbst das Spitzenpersonal von CDU/CSU und SPD wird nicht müde, solche Bündnisse höchstens als Zweckgemeinschaft, keineswegs aber als Liebesheirat, darzustellen. Gleichwohl kann eine große Koalition, besonders in Krisenzeiten, als Chance betrachtet werden. Wenn sie erst einmal eine Einigung erzielt hat, ist der Weg der Gesetzgebung kaum mehr als ein Durchwinken, die Handlungsfähigkeit der Regierung also gewahrt. Das Problem, dem wir in den letzten 100 Tagen beiwohnen konnten, ist jedoch der schwierige Aushandlungsprozess, der dem legislativen Gang durch die Institutionen vorgeschaltet ist. Trotz ihrer erdrückenden Mehrheit von 504 zu 127 Sitzen im Bundestag warten wir in den ersten 100 Tagen vergebens auf einen großen Wurf der Regierung.
Stattdessen werden kleine Lösungen und Kompromisse als Erfolge verkauft; so etwa beim Thema Mindestlohn. Zwar einigten sich die Spitzen von Union und SPD auf die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Die derzeit diskutierten Ausnahmeregelungen lassen aber keinen großen Wurf erwarten. Auch bezüglich der doppelten Staatsbürgerschaft zeichnen sich neue Streitpunkte ab. In der Außenpolitik ist das Ansehen des Auswärtigen Amtes im In- und Ausland dank Frank-Walter Steinmeier heute höher einzuschätzen als noch unter seinem Vorgänger Westerwelle, trotzdem ist von einer beherzten Außenpolitik kaum etwas zu sehen. Beispiele sind das Kleinbeigeben der Bundesregierung im Streit mit den USA um die NSA-Affäre oder das bislang fehlende Krisenmanagement Deutschlands in der Krim-Frage. Sinnbildlich ist das bis dato größte außenpolitische Zeichen der Bundesregierung ihr Fernbleiben von den Olympischen Winterspielen in Sotschi.
Nur wenige Regierungsmitglieder haben bislang „ihr“ Thema gefunden. Verteidigungsministerin von der Leyen beispielsweise hat ihrem Portfolio den eigenen Stempel aufgedrückt und geht in ihrer Rolle auf, die Bundeswehr familienfreundlicher zu gestalten. Die meisten aber schlagen sich eher mit thematischen Altlasten rum, die sie von der Vorgängerregierung geerbt haben. So ist die NSA-Affäre noch immer nicht verdaut, die Energiewende ist ins Stocken geraten und das von der schwarz-gelben Koalition eingeführte Betreuungsgeld erweist sich als Ladenhüter.
Anstatt eine Politik der Großprojekte zu betreiben und Zukunftsvisionen zu gestalten, erscheint die Bundesregierung eher als getriebenes Organ. Kleinteilige Politik und die Aufarbeitung prominenter Einzelfälle wie die von Sebastian Edathy und Uli Hoeneß zeigen dies. In diesen beiden größten Aufregern der ersten 100 Tage hat die Bundesregierung es bis dato verpasst, langfristig angelegte Konsequenzen zu ziehen. Sowohl im Kampf gegen Kinderpornografie als auch gegen Steuerbetrug wartet die Wählerschaft auf einen entscheidenden Durchbruch. Als Zäsur kann die Edathy-Affäre somit nur in Bezug auf das Arbeitsklima, nicht jedoch auf die inhaltliche Arbeit der Bundesregierung gewertet werden. Zwar blieben gesetzgeberische Konsequenzen bislang aus, personelle Konsequenzen wie der Rücktritt des ehemaligen Innenministers Friedrich wiegen jedoch schwer auf die Stimmung innerhalb der Koalition. Insbesondere die CSU dürfte aufgrund der einseitigen personellen Konsequenzen noch mit Bauchschmerzen in Regierungstagungen gehen. Offen sprachen ranghohe Regierungsmitglieder von einem Vertrauensbruch in der Koalition, der erst wieder gekittet werden müsse.
Ungeachtet dessen scheint die Koalition die ersten 100 Tage ihres Schaffens in der Gunst der Bevölkerung relativ unbeschadet überstanden zu haben. Während die Stimmung innerhalb der Regierungsmannschaft als angespannt bezeichnet werden kann, wird sie in der Bevölkerung keineswegs durch Ablehnung gestraft. Das neueste Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen bestätigt dies. Sowohl Union (41%) als auch SPD (25%) erreichen die gleichen Zustimmungswerte wie am Tag der vergangenen Bundestagswahl, während die FDP und AfD den Einzug in den Bundestag erneut verpassen würden. Auch die zehn beliebtesten Spitzenpolitiker sind bis auf eine Ausnahme (Gregor Gysi, Platz 10) durchweg Mitglieder der großen Koalition. So musste das dritte Kabinett unter der Führung Merkels trotz des trägen Beginns bislang kaum Popularität einbüßen.
Die Koalition scheint sich am zurückhaltend-präsidialen Stil der Kanzlerin angesteckt zu haben. Merkels Minister sind eher durch die Hoffnung, keine Fehler machen zu wollen, angetrieben, denn durch den Wunsch große politische Projekte in Angriff zu nehmen. Dies bestätigte Horst Seehofer nun auch in einem Interview mit dem Handelsblatt. In seinen Worten sei die große Koalition bis zur Edathy-Affäre in erster Linie mit einem Ziel beschäftigt: „Wir wollten keinen Fehlstart hinlegen“, so der CSU-Chef. Mit diesem Stil werden auch die nächsten 100 Tage kaum für inhaltliche Durchbrüche sorgen. Nur scheint sich bislang kaum jemand daran zu stören.