Viele Bürger, Leser und Debattenteilnehmer zur Causa Wulff auch in diesem Blog stellen – oft empört oder entsetzt – die Frage: Kann dieser Bundespräsident wirklich auf seinem Posten bleiben? Trotz seines vielfältigen, offenkundigen Versagens, das er in dieser Affäre unter Beweis gestellt hat?
Andere meinen: Wäre das so schlimm? Haben wir, hat unser Land nicht viel gravierendere Sorgen und Probleme als die Frage, ob ein medioker Politiker seinem Amt – einem gar nicht so bedeutenden – gewachsen ist?
Noch anders gewendet: Wäre es eine Staatsaffäre, wenn Christian Wulff nicht gehen müsste? Weil die Kanzlerin und ihre Koalition, aber auch die Opposition im Moment offensichtlich kein Interesse an seiner Ablösung haben. Und weil die Aufregung über Wulff und sein Krisengebaren langsam abebbt und sich die Medien wieder anderen Themen zuwenden. Wie das so ist, wenn eine Affäre lange dauert und keine Konsequenzen zeitigt.
Oder würde es vielmehr eine Staatskrise bedeuten, wenn Wulff schließlich doch noch zurückträte, als zweiter Bundespräsident binnen eineinhalb Jahren nach Horst Köhler?
Nein, eine Staatskrise wäre das sicherlich nicht. Im Gegenteil. Unser politisches System würde dann zeigen, dass es in der Lage ist, mit solchen Skandalen umzugehen und einen unfähigen, überforderten Politiker aus seinem Amt zu entfernen. Die Bundesversammlung würde rasch einen Nachfolger wählen, einen hoffentlich überparteilichen und besseren; Angela Merkel wäre leicht beschädigt (ist sie jetzt schon), weil es ihr Präsident ist, ihr zweiter; die Republik würde diese minder bedeutende Affäre alsbald vergessen.
Wenn. Wenn aber Wulff weiter an seinem Sessel klebt (was ihm gar nicht zu verdenken ist: Viele andere Politiker täten das auch und haben es getan – weil sie meist ja nichts anderes haben) und niemand diesen Präsidenten von seinem Amt befreit, dann, so ist zu befürchten, droht der Demokratie tatsächlich eine weitreichende neuerliche Erschütterung. Weil das in den Augen vieler Bürger den Argwohn verstärkte, dass unser politisches System seiner Funktion eben nicht mehr gerecht wird, sich selbst zu reinigen.
Erst die Finanz- und Eurokrise. Dann Guttenberg. Jetzt Wulff: Man stelle sich mal vor, es ginge um die Kanzlerin, also jemand wirklich bedeutenden, mächtigen. Aber Wulff ist ja „nur“ Bundespräsident. Gott sei Dank.





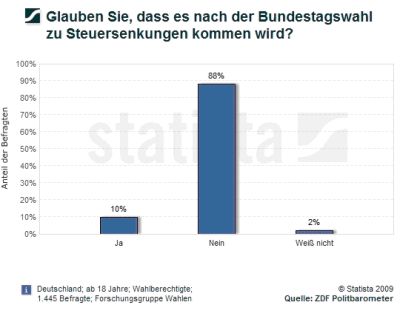


 Mit Umfragewerten von mindestens 15% in den letzten beiden Monaten ist es unwahrscheinlich, dass die FDP im kommenden Wahlkampf auf eine Leihstimmenkampagne setzt. Anders als zur Bundestagswahl 1983 wird sie die Wähler wohl nicht mit einem Rechenbeispielen à la
Mit Umfragewerten von mindestens 15% in den letzten beiden Monaten ist es unwahrscheinlich, dass die FDP im kommenden Wahlkampf auf eine Leihstimmenkampagne setzt. Anders als zur Bundestagswahl 1983 wird sie die Wähler wohl nicht mit einem Rechenbeispielen à la