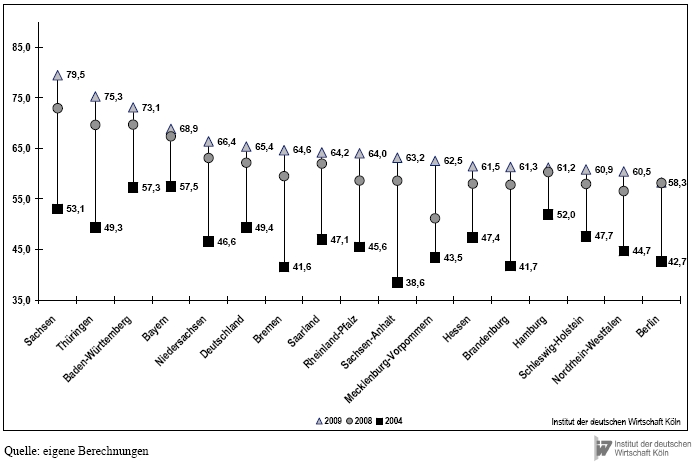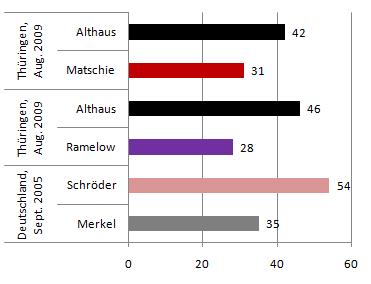Wahlergebnisse in den Bundesländern senden in der Regel immer Signale in Richtung Bundespolitik aus. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf Stimmengewinne und –verluste der Parteien, sondern auch für die Muster der Regierungsbildung. Man erinnere sich hier an die erstmalige Bildung einer rot-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen 1995: der damalige Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) und wohl auch weite Teile der strukturell eher konservativen NRW-SPD waren alles andere als glücklich mit einem solchen Bündnis, doch blieb ihnen aufgrund der Mehrheitsverteilung im Landtag und dem Druck der Bundesebene, ein solches Bündnis im einwohnerstärksten deutschen Bundesland zu installieren, um so die Regierungsfähigkeit einer solchen Koalition für die Zeit nach der Bundestagswahl 1998 zu signalisieren, nichts anderes übrig, als eine rot-grüne Koalition einzugehen.
Wahlergebnisse in den Bundesländern senden in der Regel immer Signale in Richtung Bundespolitik aus. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf Stimmengewinne und –verluste der Parteien, sondern auch für die Muster der Regierungsbildung. Man erinnere sich hier an die erstmalige Bildung einer rot-grünen Koalition in Nordrhein-Westfalen 1995: der damalige Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) und wohl auch weite Teile der strukturell eher konservativen NRW-SPD waren alles andere als glücklich mit einem solchen Bündnis, doch blieb ihnen aufgrund der Mehrheitsverteilung im Landtag und dem Druck der Bundesebene, ein solches Bündnis im einwohnerstärksten deutschen Bundesland zu installieren, um so die Regierungsfähigkeit einer solchen Koalition für die Zeit nach der Bundestagswahl 1998 zu signalisieren, nichts anderes übrig, als eine rot-grüne Koalition einzugehen.
Es gibt eine Reihe weiterer, historisch älterer Beispiele, wo Koalitionen auf Landesebene dazu dienten, die Tragfähigkeit solcher Bündnisse auf Bundesebene auszutesten. Von den Landtagswahlen im Saarland, in Thüringen und in Sachsen und dem anschließenden Regierungsbildungsprozess könnte – gerade weil sie nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl stattfinden – eine ähnliche Bedeutung ausgehen. Dies rührt vor allem daher, dass die SPD – das Debakel um die gescheiterte Bildung einer rot-grünen, von der „Linken“ tolerierten Minderheitsregierung in Hessen 2008 vor Augen – ihren Landesverbänden nicht nur im Osten, sondern nun auch im Westen freie Hand für eine Zusammenarbeit mit der SED- bzw. PDS-Nachfolgepartei gegeben hat, ein solches Bündnis jedoch auf Bundesebene nach wie vor ausschließt. Generell haben die deutschen Parteien aus der verfahrenen Situation in Hessen nach den Wahlen vom Februar 2008 gelernt und schließen weniger Koalitionsoptionen a priori aus als zuvor. Dies gilt zu einem geringeren Grad für die kommende Bundestagswahl, wo die Grünen eine Jamaika-Koalition ausgeschlossen haben und die SPD jedwedes Bündnis mit der „Linken“ ablehnen, sondern vor allem für die drei kommenden Landtagswahlen. So ist ein schwarz-gelb-grünes Bündnis weder von CDU noch von FDP und Bündnisgrünen rundweg abgelehnt worden. Auch schließt die SPD eine Koalition mit der Linken im Saarland und in Thüringen nur dann aus, wenn die Sozialdemokraten nicht den Ministerpräsidenten stellen könnten.
Jüngste Umfragen von Infratest-Dimap und der Forschungsgruppe Wahlen zeigen, dass eine Mehrheit für ein Bündnis für die in allen drei Ländern von jeweils beiden Parteien präferierte CDU/FDP-Koalition nur in Sachsen relativ sicher ist. Was sind nun dann die nächst wahrscheinlicheren Optionen? Auf der Grundlage gängiger Koalitionstheorien wissen wir, dass Parteien an der Besetzung politischer Ämter sowie an der Durchsetzung ihrer in Wahlprogrammen proklamierten inhaltlichen Positionen interessiert sind. Daraus lässt sich kurz gefasst ableiten, dass Koalitionen umso wahrscheinlicher sind, wenn sie
* über eine sie stützende Mehrheit im Parlament verfügen, diese Mehrheit jedoch nicht übergroß ist und von so wenigen Parteien wie möglich getragen wird;
* aus solchen Parteien zusammengesetzt ist, die möglichst ähnliche programmatische Positionen vertreten.
Zusätzlich gibt es theoretische Ansätze, die der stärksten Parlamentspartei einen besonderen Vorteil im Regierungsbildungsprozess zusprechen und der amtierenden Koalition einen Startvorteil im neuen Regierungsbildungsprozess zugestehen. Des Weiteren sollten die im Wahlkampf getätigten Koalitionsaussagen einen Einfluss ausüben: wird eine Aussage zugunsten einer künftigen Koalition zwischen zwei (oder auch mehr) Parteien getroffen, dann sollte dies einen positiven Effekt auf die schlussendliche Bildung dieser Koalition ausüben. Wird ein Bündnis hingegen von vorneherein abgelehnt, dann sollten die Chancen zur Bildung einer solchen Koalition sinken. In Deutschland ist ein weiterer Faktor von Bedeutung, der sich aus der Rolle des Bundesrates in der Gesetzgebung ergibt: die Parteien auf Bundesebene sind daran interessiert, in den Ländern solche Koalitionen zu „installieren“, die mit der parteipolitischen Zusammensetzung von Regierung und Opposition auf Bundesebene übereinstimmen. Wenn solche Landesregierungen die Mehrheit der Sitze im Bundesrat stellen, die aus den selben Parteien wie die Bundesregierung gebildet sind, dann sollte es für die Bundesregierung einfacher sein, ihre Gesetzesinitiativen durch die Länderkammer zu bringen als in Situationen, wo die Bundestagsopposition eine Mehrheit im Bundesrat kontrolliert.
Auf der Grundlage eines Datensatzes, der alle 79 Regierungsbildungsprozesse in Bund und Ländern seit Januar 1990 beinhaltet und davon in 66 Fällen (83,5%) die Regierungsbildung korrekt voraussagt (Bräuninger & Debus 2008, 2009), können wir mit Hilfe multivariater statistischer Analysetechniken die Wahrscheinlichkeiten ermitteln, die jede theoretisch denkbare Koalition (hierzu zählen etwa auch Einparteien-Minderheitsregierungen) nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und dem Saarland aufweist. Auf der Grundlage der letzten Umfragen wird davon ausgegangen, dass nur in Sachsen Union und Liberale eine Mehrheit im Parlament erringen, wohingegen es keine Mehrheit für eine potentielle christlich-liberale Koalition in Thüringen und an der Saar gibt. Die programmatischen Positionen der Landesparteien werden anhand einer computergestützten Analyse der Landtagswahlprogramme gewonnen. Auf der Grundlage dieser Positionen lässt sich die ideologische Distanz zwischen den jeweiligen Parteien innerhalb jeder potentiell möglichen Koalition bemessen.
Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der am stärksten diskutierten Koalitionsoptionen sind in der folgenden Tabelle 1 getrennt nach Bundesland dargestellt. In Sachsen dominiert klar eine CDU/FDP-Koalition die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse scheint somit die Fortführung der Koalition aus Union und SPD sehr unwahrscheinlich, wenn CDU und Liberale eine gemeinsame Mehrheit im sächsischen Landtag erringen. Im Saarland und in Thüringen, wo wir das Wahlergebnis mit Hinblick auf die letzten Umfragewerte so simuliert haben, dass Union und FDP keine Mehrheit in den beiden Landtagen erreichen, stehen die Chancen für die Bildung einer Koalition aus CDU und SPD gut – sie dominiert ein Linksbündnis, dessen Chancen in beiden Ländern bei rund 10% liegt, sowie auch eine Jamaika-Koalition, die jedoch mit Wahrscheinlichkeitswerten von etwas weniger als 40% auf keinen Fall als chancenlos abzutun ist.
Tabelle 1: Wahrscheinlichkeiten ausgewählter Koalitionsoptionen
| |
Saarland |
Sachsen |
Thüringen |
| CDU und SPD |
47,0% |
13,6% |
46,9% |
| CDU, FDP und Grüne |
36,6% |
0,0% |
38,4% |
| SPD, Grüne und Linke |
9,4% |
0,0% |
10,8% |
| CDU und FDP |
3,0% |
86,1% |
0,1% |
Nun basieren diese Schätzungen – wie oben beschrieben – auch auf einer Variable, die die Bedeutung der Kongruenz zwischen dem Parteienwettbewerb auf Bundes- und Landesebene umfasst. In diesem Fall impliziert dies einen positiven Effekt für eine Koalition aus CDU und SPD in den Ländern, da diese zum Zeitpunkt der Landtagswahlen im August 2009 (noch) die Bundesregierung stellen. Lässt man diese Variable aufgrund des mehr oder weniger offensichtlichen Wunsches von Union und SPD, die große Koalition in Berlin nach den kommenden Bundestagswahlen zu beenden, in den statistischen Schätzungen außer acht, dann ändert sich auch die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten auf die jeweils theoretisch möglichen Koalitionsoptionen. Die in Tabelle 2 abgetragenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf die vier momentan am häufigsten diskutierten Szenarien der Regierungsbildung zeigen nunmehr, dass sowohl im Saarland als auch in Thüringen eine „Jamaika-Koalition“ leicht wahrscheinlicher ist als ein CDU/SPD-Bündnis. Die Chancen zur Bildung einer Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Linken steigen hingegen nur geringfügig an.
Tabelle 2: Wahrscheinlichkeiten ausgewählter Koalitionsoptionen – Kongruenz zur Bundesebene wird nicht berücksichtigt
| |
Saarland |
Sachsen |
Thüringen |
| CDU, FDP und Grüne |
43,1% |
0,0% |
42,5% |
| CDU und SPD |
38,0% |
19,8% |
40,1% |
| SPD, Grüne und Linke |
12,1% |
0,0% |
13,6% |
| CDU und FDP |
3,0% |
79,8% |
0,1% |
Da maßgeblich entscheidend für die Koalitionsbildung die Stärke der Fraktionen in den Landesparlamenten ist, sind die hier geschätzten Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Koalitionsoptionen naturgemäß nur unter Vorbehalt zu betrachten. Sollten sich im Saarland und in Thüringen Mehrheiten für CDU und FDP in den Landtagen bilden, dann ist eine Koalition dieser beiden Parteien nahezu sicher. Sollte es aber keine Mehrheit für das „bürgerliche Lager“ geben, dann sind die Chancen für „Jamaika“ im Saarland nahezu ähnlich gut wie für eine CDU/SPD-Koalition – lediglich für ein Linksbündnis sieht es – überraschenderweise – nicht so gut aus, was im Saarland wohl auch an den gegensätzlichen Forderungen von Grünen und Linken zur Zukunft des Bergbaus liegen mag.
Literatur
Bräuninger, Thomas/Debus, Marc (2008): Der Einfluss von Koalitionsaussagen, programmatischen Standpunkten und der Bundespolitik auf die Regierungsbildung in den deutschen Ländern, in: Politische Vierteljahresschrift 49, 309-338.
Bräuninger, Thomas/Debus, Marc (2009): Die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2009: Wie wahrscheinlich ist eine Neuauflage der großen Koalition? Paper vorbereitet für den „Workshop zur Bundestagswahl 2009“ auf dem DVPW-Kongress in Kiel, 21. bis 25. September 2009.
 Die Bildungspolitik ist traditionell ein prominentes Wahlkampfthema. Zur Bundestagswahl 2009 jedoch scheint sich nun jedoch ein Sprung in die Riege jener Themen abzuzeichnen, die nicht nur eifrig diskutiert werden, sondern tatsächlich wahlentscheidend sind. Einer Forsa-Studie für die Zeitschrift „Eltern“ zufolge schreiben 86 Prozent der Befragten dem Bereich „Familie, Kinder, Bildung“ einen mindestens genauso großen Stellenwert zu, wie den klassischen Wahlkampfschlagern Arbeit und Wirtschaft. Für die repräsentative Umfrage wurden Eltern minderjähriger Kinder interviewt, es handelt sich also um eine auch zahlenmäßig starke (Ziel-)Gruppe.
Die Bildungspolitik ist traditionell ein prominentes Wahlkampfthema. Zur Bundestagswahl 2009 jedoch scheint sich nun jedoch ein Sprung in die Riege jener Themen abzuzeichnen, die nicht nur eifrig diskutiert werden, sondern tatsächlich wahlentscheidend sind. Einer Forsa-Studie für die Zeitschrift „Eltern“ zufolge schreiben 86 Prozent der Befragten dem Bereich „Familie, Kinder, Bildung“ einen mindestens genauso großen Stellenwert zu, wie den klassischen Wahlkampfschlagern Arbeit und Wirtschaft. Für die repräsentative Umfrage wurden Eltern minderjähriger Kinder interviewt, es handelt sich also um eine auch zahlenmäßig starke (Ziel-)Gruppe.