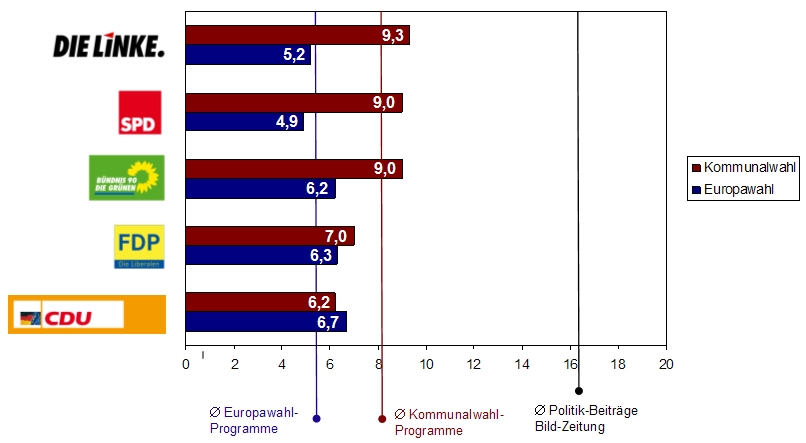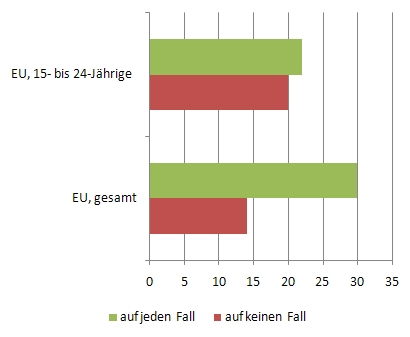Am kommenden Sonntag findet bekanntlich die Europawahl statt. Dass die Wahlbeteiligung dabei von entscheidender Bedeutung ist, wurde sowohl hier als auch in der breiteren Öffentlichkeit schon ausführlich diskutiert. Von besonderer Bedeutung ist die Wahlbeteiligung aber für eine Partei – die CSU. Ihr Schicksal am kommenden Sonntag hängt nämlich genau von ihr ab.
Am kommenden Sonntag findet bekanntlich die Europawahl statt. Dass die Wahlbeteiligung dabei von entscheidender Bedeutung ist, wurde sowohl hier als auch in der breiteren Öffentlichkeit schon ausführlich diskutiert. Von besonderer Bedeutung ist die Wahlbeteiligung aber für eine Partei – die CSU. Ihr Schicksal am kommenden Sonntag hängt nämlich genau von ihr ab.
Warum? Die CSU tritt – natürlich – nur in Bayern an. Gleichwohl muss sie alleine mit ihren bayrischen Stimmen die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, sonst ist sie zukünftig im Europäischen Parlament nicht mehr vertreten. Die Fünf-Prozent-Hürde bezieht sich dabei auf die Zahl der bundesweit abgegebenen gültigen Zweitstimmen: Fünf Prozent aller bundesweit abgegebenen gültigen Stimmen müssen ein Kreuzchen bei „CSU“ haben. Zwei Dinge sind also entscheidend für die CSU: Die Zahl der bundesweit abgegebenen Stimmen und die Zahl der für die CSU in Bayern abgegebenen Stimmen.
Der Bundeswahlleiter hat kürzlich die Zahl der Wahlberechtigten pro Bundesland veröffentlicht , demnach leben 15 Prozent der wahlberechtigten Deutschen in Bayern. Auf dieser Basis lassen sich nun einige Szenarien (samt ihrer Konsequenzen für die CSU) durchspielen:
Szenario 1: Die Wahlbeteiligung beträgt in allen Bundesländern einheitliche 43 Prozent (dem Durchschnitt von 2004)
In diesem Fall würden insgesamt 26,703 Millionen Deutsche (und 4 Millionen Bayern) ihre Stimme abgeben. Um die 5%-Hürde zu überspringen, muss eine Partei 1,335 Millionen Stimmen erhalten, was für die CSU einem Stimmenanteil von 33,4 Prozent der bayrischen Stimmen entspricht. Erreicht die CSU in Bayern 33,4 Prozent der Stimmen, ist sie drin, gelingt ihr das nicht, ist sie draußen aus dem EP.
Szenario 2: Die Wahlbeteiligung beträgt in Ländern, in denen nicht zeitgleich eine Kommunalwahl stattfindet, 33 Prozent; in Ländern mit paralleler Kommunalwahl 53 Prozent
In diesem Fall würden insgesamt 24,553 Millionen Deutsche (und 3,07 Millionen Bayern) ihre Stimme abgeben. Um die 5%-Hürde zu überspringen, muss eine Partei 1,228 Millionen Stimmen erhalten, was für die CSU einem Stimmenanteil von 40,0 Prozent der bayrischen Stimmen entspricht.
Szenario 3: Die Wahlbeteiligung beträgt in Ländern, in denen nicht zeitgleich eine Kommunalwahl stattfindet, 33 Prozent; in Ländern mit paralleler Kommunalwahl 53 Prozent, in Bayern aber wegen schönen Wetters nur 30 Prozent
In diesem Fall würden insgesamt 24,274 Millionen Deutsche (und 2,79 Millionen Bayern) ihre Stimme abgeben. Um die 5%-Hürde zu überspringen, muss eine Partei 1,214 Millionen Stimmen erhalten, was für die CSU einem Stimmenanteil von 43,5 Prozent der bayrischen Stimmen entspricht – einem Zehntelprozentpunkt mehr, als sie bei der Landtagswahl 2008 erhielt.
Es verspricht ein spannender Wahlsonntag zu werden, allen voran für die CSU.
PS: Eine andere Kuriosität im Zusammenhang mit dem Antreten der CSU bei der Europawahl ist inzwischen hier diskutiert.
 Das Format hatten wir in ähnlicher Besetzung schon einmal: Erst kürzlich war Angela Merkel zu Gast bei Anne Will, gestern Abend dann beim ZDF. Auf die Frage: „Was haben Sie mit Deutschland vor“ hatte Frau Merkel eine gute Stunde Zeit, Antworten und Ausführungen zu geben. Auch hier hatten zwei Gäste im Publikum die Möglichkeit, ihre Fragen an die Kanzlerin zu stellen. So etwas schafft für den Zuschauer Nähe und Vertrauen. Wie gesagt, mittlerweile ein vertrautes Format!
Das Format hatten wir in ähnlicher Besetzung schon einmal: Erst kürzlich war Angela Merkel zu Gast bei Anne Will, gestern Abend dann beim ZDF. Auf die Frage: „Was haben Sie mit Deutschland vor“ hatte Frau Merkel eine gute Stunde Zeit, Antworten und Ausführungen zu geben. Auch hier hatten zwei Gäste im Publikum die Möglichkeit, ihre Fragen an die Kanzlerin zu stellen. So etwas schafft für den Zuschauer Nähe und Vertrauen. Wie gesagt, mittlerweile ein vertrautes Format!