Wieso wertet der Euro eigentlich ständig auf? Vielleicht ist es die Erwartung, dass die Zinsen steigen werden, jedenfalls relativ zu denen der USA, oder dass der Dollar fallen muss, es aber gegenüber den Hauptkandidaten, den Währungen der asiatischen Schwellenländer und der Ölexporteure, wegen massiver Stützungsoperationen nicht kann. Der Euro als weinender Dritter?
Es kann jedenfalls nicht an der Entwicklung der europäischen Leistungsbilanz liegen, dass der Euro so stark ist, denn deren Saldo ist seit Jahren mehr oder weniger ausgeglichen. Wie die beiden ersten Schaubilder zeigen, war der Euro sogar dann fest, als es noch ziemlich große Defizite gab.
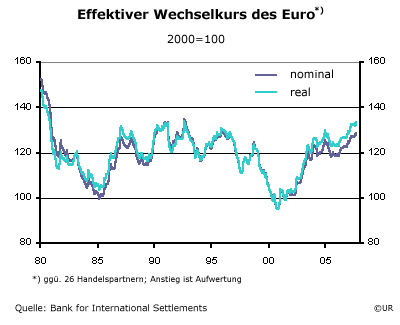
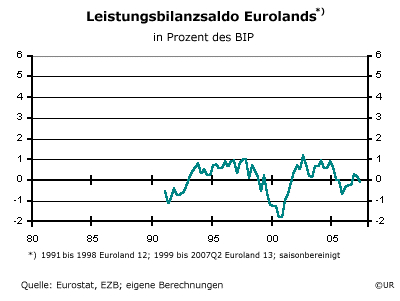
Die Entwicklungen der japanischen Leistungsbilanz und des Yen legen einen ähnlichen Schluss nahe: Die Überschüsse wollen und wollen nicht kleiner werden und bewegen sich seit langem im dreistelligen Dollarmilliardenbereich, der Yen aber setzt derweil ganz unbeirrt seine Talfahrt fort. Bedeuten die positiven Salden nicht, dass es eine große Nettonachfrage nach Yen gibt, die sich in einem festen Wechselkurs niederschlagen sollte? Offenbar ist das nicht der Fall. Für den Euroraum und Japan sind die Veränderungen der Leistungsbilanzen wertlos für die Prognose der Wechselkurse, es sei denn, man denkt in Dekaden statt in kürzeren Zeiträumen.
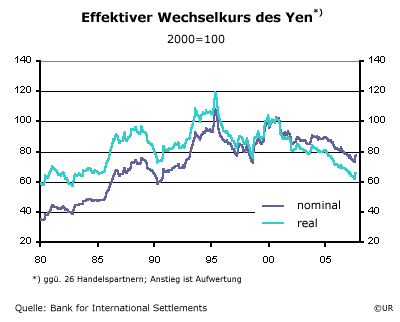
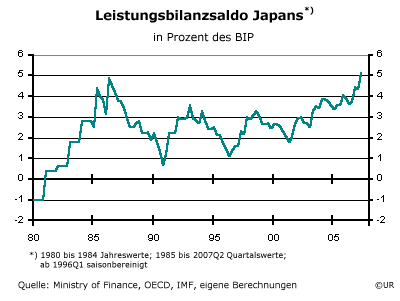
Für den Dollar stimmt die übliche Vermutung allerdings die meiste Zeit: hohe Defizite gleich schwache Währung. Aber wenn man genauer hinsieht, gilt das auch nicht immer, vor allem nicht in letzter Zeit. Die amerikanische Leistungsbilanz hat sich nämlich seit fast zwei Jahren relativ zum nominalen US-Bruttoinlandsprodukt verbessert, die Abwertung hat sich aber eher beschleunigt als verlangsamt.
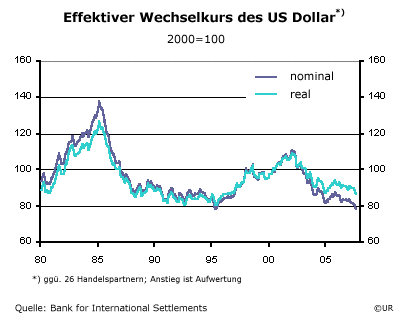
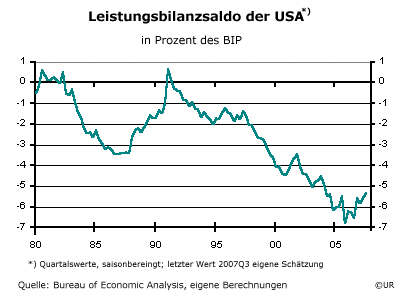
Im allgemeinen wird das amerikanische Leistungsbilanzdefizit als das wichtigste Ungleichgewicht der Weltwirtschaft überhaupt angesehen, also als etwas, was nicht haltbar ist und daher verschwinden wird, und zwar in erster Linie dadurch, dass sich die relativen Preise kräftig ändern. Konkret heißt das, dass der Dollar im Verlauf dieses unvermeidlichen Prozesses stark abwerten wird. Es ginge auch über eine längere Rezession in den USA, bei anhaltend positivem Wachstum in der übrigen Welt; das wäre aber zumindest aus amerikanischer Sicht eine unerfreuliche Alternative.
Das Defizit ist gesamtwirtschaftlich gesehen gleich der Differenz zwischen Sparen und Investieren, und daher gleich dem Nettokapitalimport der USA. Das reichste Land der Welt ist gleichzeitig der bei weitem größte Kapitalimporteur, während die ärmsten Länder, China, Indien oder Russland zu den großen Kapitalexporteuren zählen, obwohl sie doch so dringend ihren eigenen Kapitalstock vergrößern sollten, damit es ihnen künftig besser geht.
Viele Amerikaner „couldn’t care less“, was das Defizit in der Leistungsbilanz angeht. Wieso Ungleichgewicht? Greenspan geht in seinen Memoiren sogar so weit zu sagen, dass es „eine Menge Ungleichgewichte gibt, insbesondere das Haushaltsdefizit der US-Zentralregierung, über die man sich Sorgen machen kann, aber das Defizit der Leistungsbilanz kommt so ziemlich an letzter Stelle.“ (S. 347) Steigende Schulden sind in einer wachsenden Wirtschaft das Allernormalste. Greenspan macht sich darüber lustig, dass alle Welt zu fürchten scheint, das Defizit würde letztlich sowohl zu einem Kollaps des Dollarkurses als auch zu einer weltweiten Finanzkrise führen. Er denkt, dass Defizite in der gegenwärtigen Größenordnung auf Jahre hinaus schadlos durchzuhalten seien. Warum? Zum Einen habe im Zuge der Globalisierung der sogenannte „home bias“ abgenommen, dass heißt die Sparer suchen zunehmend die gesamte Welt und nicht nur ihr eigenes Land nach Anlagemöglichkeiten ab. Zum Anderen habe es in den USA, mehr als in der übrigen Welt, einen Produktivitätsschub gegeben, der US-Investments einfach unschlagbar mache (S. 350). Durch die Kapitalzuflüsse entsteht zwangsläufig ein großes Defizit in der Leistungsbilanz. Nichts falsch daran! Es zeigt die Attraktivität der amerikanischen Märkte. Diese Einstellung ist in den USA ziemlich verbreitet.
Greenspan räumt zwar ein, dass die Anleger irgendwann mal finden könnten, dass der Dollaranteil in ihren Portefeuilles groß genug sei, oder dass die positive Einstellung gegenüber dem Dollar auch mal schnell ins Gegenteil umschlagen könnte, was jeweils einen scharfen Kursrückgang bewirken könnte. Er hat aber keine Angst davor, genauso wenig wie er etwas dabei findet, wenn die Haushalte hohe Schulden haben. Das ist einfach ein Charakteristikum einer reichen Volkswirtschaft. Schließlich nimmt ja das Vermögen noch rascher zu.
Das gilt insbesondere für das Nettovermögen der amerikanischen Haushalte – es liegt etwa bei dem Fünffachen des nominalen Bruttosozialprodukts, also bei 70 Billionen Dollar. Da nimmt sich eine internationale Nettoanlageposition von minus 2 1/2 bis 4 1/2 Billionen Dollar (je nach Quelle) geradezu bescheiden aus. Was macht das schon? Zudem argumentiert Greenspan, wie auch andere, dass die Erträge aus US-Anlagen im Ausland deutlich höher sind als der Schuldendienst auf US-Verbindlichkeiten, was der Grund dafür sei, dass die Bilanz der Kapitaleinkommen immer noch positiv sei. Die Auslandsanlagen der USA bestehen vorwiegend aus Aktien und Direktinvestitionen, die eine um rund drei Prozentpunkte höhere Verzinsung aufweisen als die amerikanischen Verbindlichkeiten, bei denen festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente überwiegen. Die Schulden tun also nicht weiter weh.
Francis E. Warnock, Stephanie E. Curcuru und Tomas Dvorak konnten allerdings in einem Arbeitspapier („Cross-Border Returns Differentials„), das am 8. Oktober auf der ECB-CFS-Konferenz in Dublin vorgestellt wurde, zeigen, dass die Renditedifferenz fast ausschließlich auf einer systematischen Überschätzung der „capital gains“, also der Wertsteigerung von US-Direktinvestitionen im Ausland (die als Ertrag gebucht werden) beruht. Mit anderen Worten, der grenzüberschreitende Schuldendienst ist für die USA ein zunehmend ernstes Problem. Es bleibt dabei: Die amerikanische Leistungsbilanz ist ein bedeutendes, wenn nicht tatsächlich das bedeutendste Ungleichgewicht der Weltwirtschaft, das durch Dollarabwertung und/oder Wachstumsdifferenzen beseitigt werden muss. Beide Prozesse laufen.
Fred Bergsten, ein bekannter Dollar-Bär aus Washington, argumentiert heute in der Financial Times Europe nicht zum ersten Mal, dass die überdurchschnittliche Zunahme der US-Produktivität, die die Anlagen in Amerika im vergangenen Jahrzehnt so attraktiv gemacht hat, inzwischen der Vergangenheit angehört. Hätte ja auch überrascht, wenn es anders wäre. Warum soll der Erfinder auf Dauer besser dastehen als der Käufer oder der Kopierer einer technischen Neuerung, beispielsweise des Internets oder eines revolutionären Medikaments? Zudem haben die asiatischen Staaten und die Ölexporteure mehr Dollarreserven angehäuft, als sie plausiblerweise benötigen. China interveniert zur Zeit aufgrund gewaltiger Leistungsbilanzüberschüsse und privater Kapitalzuflüsse in der Größenordnung von 40 bis 50 Mrd. Dollar pro Monat zugunsten des Dollar. Das kann nicht so weitergehen, nicht zuletzt weil es sich dabei laut IWF-Regeln um eine verbotene kompetitive Unterbewertung des Yuan durch langanhaltende und erhebliche Interventionen handelt. Diese Politik widerspricht auch dem Geist des WTO-Vertrags, der jede Art von Exportsubventionen untersagt, und sei es durch eine künstliche Unterbewertung der Währung.
Bergsten argumentiert, dass der Dollar im Durchschnitt von hier aus noch um 15 bis 20 Prozent abwerten muss. Da nur die Europäer ihren Wechselkurs laufen lassen, werden sie sich vermutlich auf eine noch viel größere bilaterale Aufwertung gefasst machen müssen. 1,60 Dollar pro Euro könnten schnell erreicht werden. Das sind ja schließlich nur noch weitere 13 Prozent.
Die Leistungsbilanzen spielen zusammen mit den Zinsdifferenzen (Japan!) letztlich also doch die entscheidende Rolle für die Wechselkurse. Dass sie sich nicht immer sofort durchsetzen, liegt an den Interventionen der Länder, die ihre Wechselkurse zum Dollar zu stabilisieren versuchen. Aber wie wir aus den letzten Jahren des Bretton Woods-Systems wissen, kommen auch Interventionen einmal an ihr natürliches Ende, vor allem weil sie inflationär wirken und eine unabhängige Geldpolitik verhindern. China, Indien, Russland, aber auch Saudi-Arabien machen gerade diese Erfahrung. In der Zwischenzeit: auf in Richtung 1,60! Wer glaubt noch daran, dass die EZB demnächst die Zinsen erhöhen wird?