Bisher hatte ich immer gedacht, dass sich so etwas wie die Finanzkrise von 1997/98 nicht wiederholen würde. Warum? Weil die Schwellenländer ihre Lektionen damals gelernt und in der Folge so solide gewirtschaftet hatten, dass sie nicht mehr von ausländischen Geldgebern abhängig waren. Wäre es dabei geblieben, hätte der Internationale Währungsfonds in nicht allzu ferner Zukunft mangels Betätigungsfeld zumachen können. Das ist nicht geschehen, ich habe mich geirrt. Trotz ihrer stark gestiegenen Währungsreserven geraten viele Schwellenländer jetzt in Zahlungsschwierigkeiten. Wie konnte es dazu kommen?
Es stimmt schon, dass die Schwellenländer als Gruppe inzwischen zu Netto-Kapitalexporteuren geworden sind – Netto-Kapitalausfuhren sind der Gegenposten zu den Überschüssen in ihren Leistungsbilanzen. Und diese waren in den vergangenen zehn Jahren gewaltig, sowohl absolut als auch in Relation zu ihrem Sozialprodukt. Im Wesentlichen entsprachen die Leistungsbilanzdefizite der USA und Großbritanniens den Überschüssen der Schwellenländer. Sie schlugen sich in einem bisher nicht gekannten Anstieg der Währungsreserven nieder, aber auch in einer Zunahme der privaten Kapitalexporte. Für die Finanzierung ihrer Einfuhren hätte den Schwellenländern ein viel geringeres Reserveniveau genügt – das Problem war, dass sie lange Zeit bestrebt waren, ihre Währungen unterbewertet zu halten mit dem Ziel, ihre Exporte und damit ihr Wirtschaftswachstum zu stimulieren.
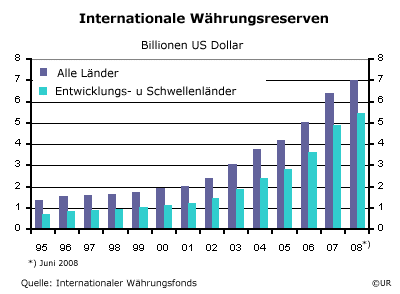
Hier lag dann aber auch das Problem. Die Interventionen am Devisenmarkt, also die Abgabe von Inlandswährung in den Markt, führten zu einer starken Expansion der Geldmenge. Zusammen mit dem raschen Wachstum des BIP ergab das steigende Inflationsraten und relativ hohe Notenbankzinsen. Da abzusehen war, dass Währungen, die künstlich niedrig gehalten wurden, über kurz oder lang aufwerten würden, bestand für private Haushalte, Banken und andere Unternehmen in diesen Schwellenländern ein starker Anreiz, sich in niedrig verzinslichen Währungen wie dem Schweizer Franken, dem Yen, dem Euro und vor allem dem Dollar zu verschulden und damit Projekte im Inland zu finanzieren. Das schlug sich in beträchtlichen privaten Kapitaleinfuhren nieder, was die Währungsreserven noch mehr aufblähte und die Wahrscheinlichkeit einer Aufwertung weiter erhöhte.
Über den Umfang dieser privaten Kapitalimporte gibt es keine verlässlichen Informationen. Er war jedenfalls so beträchtlich, dass Länder, die diese Strategien nicht durch Kapitalverkehrskontrollen verhinderten, in größte Zahlungsschwierigkeiten gerieten, als – erstens – die Kreditkrise die Banken in den Hartwährungsländern zu einer unerwartet restriktiven Politik gegenüber den Schuldnern zwang und als – zweitens – die Aufwertungsphantasie für die Währungen der Schwellenländer verschwand. Einer der Gründe war der Verfall der Rohstoffpreise, ein anderer der Rückgang der Exporte in die rezessionsgeplagten OECD-Länder. Auch eine unterbewertete Währung hilft nicht viel, wenn die amerikanischen, europäischen oder japanischen Kunden gar nicht in der Lage oder willens sind, Geld für Importe auszugeben.
Wenn Kredite nicht mehr problemlos verlängert, sondern vielmehr eingefordert werden, müssen sich die Schuldner Fremdwährungen beschaffen. Sie bieten also auf dem Devisenmarkt ihre eigene Währung an. Versucht die Notenbank nicht länger, einen bestimmten Wechselkurs zu halten, wertet die Inlandswährung mehr oder weniger stark ab, bleibt sie dagegen bei ihrem Wechselkursziel, verliert sie Währungsreserven. Beides verschlechtert zunächst tendenziell das Rating des betreffenden Landes, was sich wiederum in noch ungünstigeren Kreditkonditionen niederschlägt. Ein Nebeneffekt, der die Sache noch verschlimmert, besteht darin, dass die Schuldner Aktiva veräußern müssen, um nicht zahlungsunfähig zu werden. Das führt vielfach zu Notverkäufen und damit zu einem Einbruch von Aktienkursen und Immobilienpreisen. Die Spirale dreht sich weiter und ist bei freien Märkten oft nur schwer zu stoppen. Die Zahlungsprobleme lassen sich ohne Hilfe von außen am Ende nicht mehr lösen. Der IWF und seine Überbrückungskredite in Dollar und Euro sind wieder gefragt, vielfach aber auch die wichtigsten Handelspartner, oder die EU.
Betroffen sind diesmal nicht Malaysia, Indonesien, Thailand oder Argentinien, sondern Island, Ungarn, die Ukraine, die drei baltischen Staaten, Weißrussland, die Türkei, Pakistan und Südafrika. Auf der Kippe stehen Polen, Süd-Korea, aber auch drei der vier BRIC-Länder, nämlich Brasilien, Indien und sogar das reservereiche Russland. Dort haben sich die Währungsreserven der Notenbank in nicht einmal drei Monaten von $597 Mrd. auf $485 Mrd. verringert – niemand hatte eine Vorstellung davon, wie stark der private Sektor im Ausland tatsächlich in der Kreide stand. Paul Krugman hat vor ein paar Tagen in der New York Times bekannt, wie schockiert er darüber ist, dass die Finanzkrise nun auch Russland, Korea und Brasilien erreicht hat..
Es zeigt sich wieder einmal, dass es auf Dauer unmöglich ist, ohne Kapitalverkehrskontrollen feste Wechselkurse dauerhaft zu verteidigen, es sei denn man verzichtet auf eine autonome Zinspolitik. Lässt man die Zinsen im Ernstfall allerdings so stark steigen, dass der Wechselkurs da bleibt, wo man ihn haben möchte, kann das zu Arbeitslosenquoten im zweistelligen Bereich führen. Das lässt sich politisch in kaum einem Land durchhalten. Allerdings: Wird eine Krise dennoch einmal durchgestanden, ist neue Glaubwürdigkeit der Lohn. Dann gibt es auch wieder niedrige Zinsen. Dänemark, Schweden und auch die Tschechische Republik haben gezeigt, wie es gehen kann. Die Länder, die der Europäischen Währungsunion beitreten möchten, müssen meistens auch einmal durch ein solches Tal der Tränen. Das Schöne daran ist, dass ein Land nur einmal da durch muss. Wenn es geschafft ist, sinkt die Krisenanfälligkeit und es winken vergleichsweise niedrige Realzinsen. Eine andere, nicht ganz so überzeugende Alternative, mit der sich Zahlungskrisen vermeiden lassen, besteht darin, seine Geldpolitik per Currency Board auf die EZB oder die Fed zu übertragen, das heißt de facto auf eine eigene Geldpolitik zu verzichten. China wiederum hat Erfolg damit, dass es private Kapitalimporte erschwert.
Hohe Währungsreserven sind, wie wir also gerade lernen, nicht unbedingt ein verlässliches Mittel gegen Abwertungen und Zahlungsunfähigkeit. Und ein zweites Bretton Woods-Abkommen ist in der Tat ein wichtiges Projekt zur Stabilisierung der Weltfinanzen. Fragt sich nur, welcher Institution das Sagen über die globale Geldpolitik übertragen werden sollte. Ich hätte etwas dagegen, wenn es wieder die Fed würde. Vielleicht reichen ja auch drei oder vier große Währungsblöcke à la EU 15 – dadurch wäre sichergestellt, dass jeweils der größte Teil des Handels und des Kapitalverkehrs in einer einheitlichen Währung – der eigenen – abgewickelt würden.