Am Mittwoch hat Martin Wolf in der Financial Times einen Artikel über Balance Sheet-Rezessionen geschrieben und ist mir damit etwas zuvorgekommen. Seit einigen Tagen lese ich in der S-Bahn das im vergangenen Sommer erschienene neue Buch von Richard Koo, dem Chefökonom des Nomura Research Institute. Es heißt „The Holy Grail of Macroeconomics“ und ist eine erweiterte und aktualisierte Version seiner bahnbrechenden, wenn auch lange Zeit nicht sehr ernst genommenen Studie zur „Balance Sheet Recession“ vom Februar 2003.
Richard Koo schreibt unterhaltsam, belegt alles anschaulich mit empirischem Material und vor allem: Seine Analysen haben sich als außerordentlich wertvoll erwiesen, schon weil es so wenig Vergleichbares über die Prozesse nach dem Platzen von Asset Price-Blasen gibt. An den Universitäten war das Studium der Makroökonomie lange Jahre wenn nicht verpönt, so doch im Vergleich zu Finance und Mikro als ziemlich irrelevant angesehen worden, und dass es so etwas wie eine Depression noch einmal geben könnte, wurde angesichts der angeblich wundervoll funktionierenden Märkte schlichtweg geleugnet. Nun ja, das ändert sich gerade dramatisch.
Bernanke, der Chef der Fed und beruflich stark an Makrothemen interessiert, hat einmal angemerkt, dass derjenige den heiligen Gral der Makroökonomie finden wird, der die Vorgänge vor und während der amerikanischen Depressionsjahre schlüssig analysieren kann. Ihm selbst ist es nicht ganz gelungen, obwohl er sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Auf die Aussage von Bernanke bezieht sich Koo im Titel seines Buches. Ich finde, dass er darin dem Gral ziemlich nahe kommt (Wie ist das eigentlich, ist in der Mythologie vorgesehen, dass er jemals gefunden wird?) – er studiert nicht nur die Depression der dreißiger Jahre, sondern eine ebenfalls ziemlich traumatische Episode der Wirtschaftsgeschichte, die lange japanische Rezession und Deflation der letzten beiden Jahrzehnte, und kann daher allgemeingültigere Schlüsse ziehen als diejenigen, die nur eine der beiden Krisen analysieren.
Dass Richard Koo so wenig zitiert wird, hat offenbar damit zu tun, dass er nicht in akademischen Zeitschriften veröffentlicht, keinen anspruchsvollen mathematischen Apparat verwendet und dass Japan bisher als Sonderfall angesehen wurde. Der Tenor war ja meist, dass wir, im ökonomisch aufgeklärten Westen, die unglaublichen Fehler Japans nicht wiederholen würden und zudem strukturell viel besser aufgestellt seien.
Der springende Punkt bei Koo ist, dass für ihn die „verlorenen 15 Jahre“ Japans keineswegs verlorene Jahre waren. Als die Asset Price-Blasen Anfang der neunziger Jahre platzten, kam es insgesamt zu Vermögensverlusten gegenüber dem Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung von 1.500 Billionen Yen – das entsprach dem Dreifachen des nominalen japanischen Sozialprodukts. Die Amerikaner hatten während der dreißiger Jahre „nur“ einen Verlust in Höhe eines jährlichen Sozialprodukts erlitten (dem von 1929). Wenn man sich vor Augen hält, dass das reale Sozialprodukt der USA während der Depression in vier Jahren um insgesamt 46% einbrach und die Arbeitslosenquote auf 25% anstieg, war die durchschnittliche Wachstumsrate Japans von etwas unter 2% pro Jahr (es gab ein paar Minirezessionen zwischendurch) eine richtige Erfolgsstory, ebenso die Tatsache, dass die Arbeitslosenquote in diesen langen Jahren unter 5,5% gehalten werden konnte. Japan hat aus den amerikanischen Erfahrungen gelernt und nicht viel falsch gemacht.
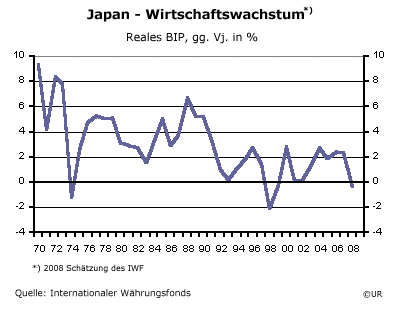
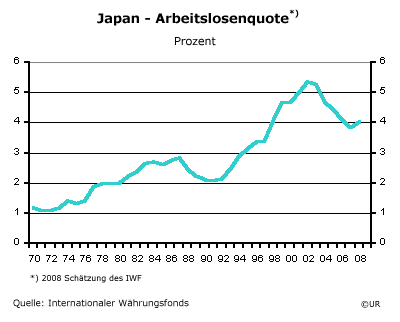
Das Hauptproblem, mit dem die japanischen Wirtschaftspolitiker zu kämpfen hatten, war das Bestreben von Haushalten, Banken und anderen Unternehmen, ihre Schulden abzubauen. Sie hatten während der „Bubblejahre“ den Kauf von Aktien, Immobilien (und Anteilen an Golfclubs!) zunehmend mit Krediten finanziert, die Banken waren da nicht kleinlich, und die Produktionsunternehmen hatten in den vorangegangenen langen Jahren der Hochkonjunktur auf Teufel komm raus investiert, ebenfalls zunehmend auf Pump. Als die Blasen platzten, waren sie alle auf einmal finanziell unter Wasser – die Schulden waren höher als der Wert der Aktien und Immobilien, die sie damit finanziert hatten.
Den japanischen Schuldnern ging aber im großen Ganzen nicht das Geld aus, wie Richard Koo betont. Die Arbeitslosigkeit hielt sich ja in Grenzen. Ähnlich war es im Unternehmenssektor: Die Anzahl der Insolvenzen stieg zwar stark an, es kam aber nicht zu einem Flächenbrand. Die Banken hatten nämlich, nicht zuletzt auf Drängen der Regierung, viel Geduld beim Eintreiben ihrer Forderungen und tendierten dazu, im Zweifel die Kredite zu verlängern und die Schuldner so am Leben zu halten (Die Zinsen waren ohnehin schon bald in der Nähe von Null). Dafür wurden die Banken ihrerseits von der Regierung mit nachrangigen Krediten, die Eigenkapitalcharakter hatten, unterstützt.
Sowohl die Haushalte als auch der Staat hatten im Übrigen noch 1990 gewaltige Finanzierungsüberschüsse (10% und 2% des BIP) und standen insofern viel besser da als ihre heutigen Pendants in den USA und Großbritannien. Die Haushalte waren nach dem Crash der Vermögenspreise allerdings gezwungen, ihre Ersparnis zurückzufahren: Trotz Schuldenabbau wollten sie ihren Lebensstandard nicht zu sehr einschränken – was sich aber trotzdem nicht vermeiden ließ. Nach der anhaltenden Schwäche des privaten Verbrauchs zu urteilen, gilt das auch heute noch.
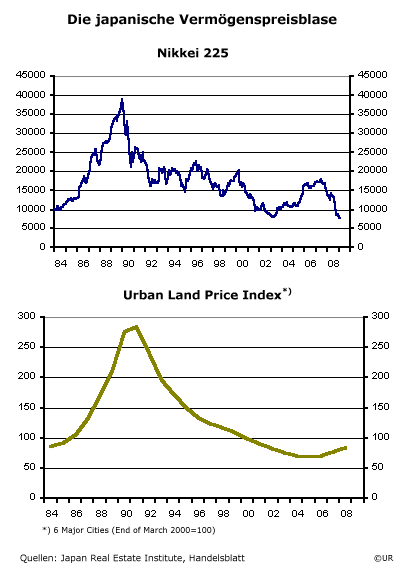
Dass die japanische Wirtschaft nach dem Vermögensschock so gut über die Runden kam, lag sicher nicht allein und auch nicht vor allem an der Geldpolitik. Koo zeigt, dass niedrige Zinsen die Nachfrage und damit die Konjunktur nicht stimulieren können, wenn alle bestrebt sind, erst einmal ihre Schuldenberge abzutragen. Der japanische Unternehmenssektor als Ganzes hatte 1990 noch ein lehrbuchgerechtes Finanzierungsdefizit von etwa 10% des BIP – bis 2004 war daraus im Verlauf der Schuldentilgungsorgie ein Überschuss von rund 8% geworden. Dieser Swing hätte leicht eine Katastrophe auslösen können. Was Japan entscheidend geholfen hat, war die Bereitschaft des Staates, Budgetdefizite gewaltigen Ausmaßes hinzunehmen, ebenso wie es half, dass Herr und Frau Watanabe, die japanischen Müller, Meiers, Schmidts, beschlossen, es mit dem Sparen nicht zu übertreiben. Anders als während der amerikanischen Depression konnte so die gesamtwirtschaftliche Nachfrage einigermaßen stabilisiert werden.
Die Lehre, die daraus zu ziehen ist, und die Koo zieht, lautet: Wenn die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen wegbricht, weil sowohl die Unternehmen als auch die Haushalte an nichts anderes denken, als ihre individuellen Bilanzen in Ordnung zu bringen, muss der Staat ran. Niedrige Zinsen und eine Stützung des Finanzsektors helfen dabei, sind sogar unverzichtbar, aber ohne einen verschuldungswilligen Staat geht es nicht. Obwohl es wünschenswert wäre, müssen nicht alle staatlichen Ausgaben und Steuersenkungen optimal sein – wichtiger ist, dass überhaupt Ersatz für den Ausfall der privaten Nachfrage geschaffen wird. Wenn der Staat nicht energisch eingegriffen hätte, wäre es auch in Japan zu einer Depression gekommen.
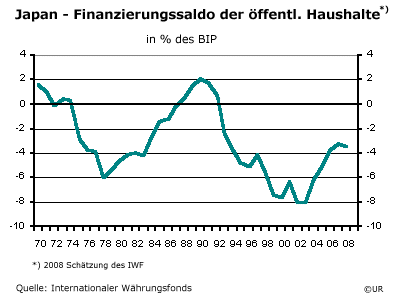
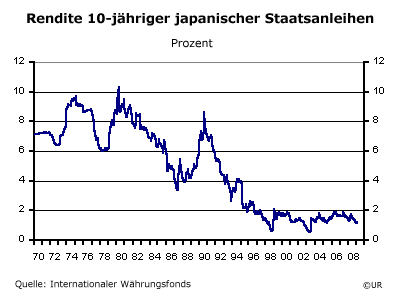
Wie die obigen beiden Graphiken eindrucksvoll belegen, haben Japans Budgetdefizite und staatlichen Schuldenberge bisher nicht dazu geführt, dass die Inflationserwartungen und mit ihnen die Renditen der Regierungsanleihen in die Höhe gegangen sind. Ganz im Gegenteil, sowohl der Yen als auch die Schuldverschreibungen der öffentlichen Hand gelten als die sichersten Geldanlagen überhaupt. Ich denke, die Sache sähe anders aus, wenn Japan nicht ein so großer Gläubiger gegenüber dem Rest der Welt gewesen wäre. Aber Deutschland ist in einer ähnlichen Situation und hat daher beträchtlichen Spielraum. Gerade sind die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen auf 3,00% gefallen, trotz aller Stützungsaktionen und Konjunkturprogramme der Regierung. Auch Euroland als Ganzes steht sehr gut da und hat Spielraum für eine deutlich expansivere Finanzpolitik.