Der Euro war im vergangenen Jahrzehnt das beste Konjunkturprogramm, das sich denken lässt. Bisher hat Deutschland außerordentlich vom Euro profitiert: vom stabilen innereuropäischen Wechselkurs, der es ermöglichte, durch Lohnzurückhaltung die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, vom relativ schwachen Wechselkurs gegenüber Drittwährungen, den niedrigen Notenbankzinsen, dem Zufluss von Fluchtgeldern und, in dessen Gefolge, den rekordniedrigen langfristigen Zinsen – das Ganze bei Preisstabilität. Das neue Wechselkursregime hat uns ein wachstumsfreundliches Umfeld beschert. Auch aus diesem Grund ist es im nationalen Interesse, dass der Euro überlebt.
Unter dem Druck der Märkte sind die Politiker Eurolands in diesen Tagen gezwungen, die Währungsunion endlich durch eine gemeinsame finanzpolitische Struktur weiterzuentwickeln und damit gegen Schocks zu wappnen. Ich glaube immer noch, dass ihnen das gelingen wird, schon weil ein Auseinanderbrechen geradewegs in einen Bankencrash und eine Rezession, wenn nicht sogar Depression führen würde. Noch kann die deutsche Seite bestimmen, wo es langgehen soll. Das Zeitfenster wird aber nicht mehr lange offen bleiben.
Gegenüber diesem alles beherrschenden Thema ist ziemlich aus dem Blickfeld geraten, wie gesund die deutsche Wirtschaft zurzeit ist. Das zeigen insbesondere die detaillierten Zahlen für das Sozialprodukt im dritten Quartal, die am 24. November veröffentlicht wurden.
Frühindikatoren wie die Auftragseingänge in der Industrie und beim Bau oder der Ifo-Indikator weisen allerdings seit einigen Monaten deutlich nach unten, so dass ein Abgleiten in eine neue Rezession nicht mehr unwahrscheinlich ist. Auf einen goldenen Herbst könnte ein sehr kalter Winter folgen. In zu vielen Ländern wird wegen Budgetproblemen eine prozyklische Finanzpolitik verfolgt. Hinzu kommen die Versuche großer, international tätiger Banken, ihre Bilanzen ins Lot zu bringen, indem sie Aktiva verkaufen und Mitarbeiter entlassen. Das drückt auf die Wertpapiermärkte und die Stimmung. Immobiliencrashs zwingen derweil die Haushalte in den USA, in Japan, Spanien, Irland und anderswo, ihre Schuldenberge abzutragen. Bald könnte es auch in China, Kanada, Frankreich, Australien, den Niederlanden und Großbritannien zu Crashs kommen, weil dort die Immobilienpreise im Vergleich zu den Einkommen und Mieten immer noch überhöht sind (dazu gibt es im Economist vom 26. November auf Seite 87 einige aufschlussreiche Zahlen). All das ist pro-zyklisch und sehr beängstigend, vor allem weil die Geldpolitik kaum mehr Pfeile im Köcher hat. Unter Null können die Notenbankzinsen nicht sinken.
Immerhin, die Widerstandskraft der deutschen Volkswirtschaft dürfte beachtlich sein: Die Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe sitzen im Allgemeinen auf Bergen von Liquidität, die Ersparnisse der Haushalte haben fast wieder das hohe Vorkrisenniveau erreicht, die Arbeitslosenquote ist in den letzten Jahren von über 12 Prozent auf 7 Prozent gesunken, so dass es bisher relativ leicht fiel, einen Job zu finden, und das Haushaltdefizit des Staates ist auf etwa ein Prozent des Sozialprodukts gesunken – wenn erforderlich, kann die öffentliche Hand also etwas für die Konjunktur tun.
Die Zahlen im Einzelnen: Das reale BIP war saisonbereinigt im dritten Quartal gegenüber dem zweiten annualisiert um 2,0 Prozent gestiegen und lag damit um 2,6 Prozent über seinem Vorjahreswert. Auch wenn es in den letzten drei Monaten des Jahres zu einem leichten Rückgang kommen sollte, wofür die rückläufigen Frühindikatoren sprechen, wird für 2011 insgesamt im Vorjahresvergleich immer noch eine durchschnittliche Zuwachsrate von 3,0 Prozent herauskommen. Das ist deutlich besser als die Ergebnisse für die USA (1,8 Prozent), Japan (-0,2 Prozent) oder Großbritannien (0,9 Prozent).
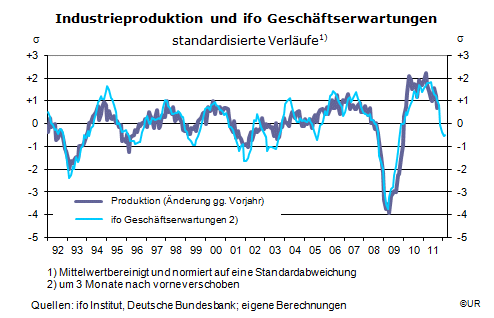
Bis zuletzt brummte der Exportmotor, dem Euro und den dynamischen Schwellenländern sei Dank. Die realen Ausfuhren von Gütern und Dienstleistungen übertrafen in Q3 ihren Vorjahresstand um 8,1 Prozent, so dass die Exportquote mittlerweile 50,9 Prozent erreicht hat. Nicht weniger erfreulich entwickelten sich die Ausrüstungsinvestitionen (zuletzt 7,3 Prozent des BIP), die real von Q2 auf Q3 mit einer annualisierten Rate von 12,1 Prozent zulegten und damit um 7,5 Prozent über ihrem Vorjahresstand lagen. Die Unternehmen investieren! Sie vergrößern auf diese Weise den Kapitalstock, der neben dem „Humankapital“ die wichtigste Basis für künftigen Wohlstand ist.
Sie können sich allerdings auch nicht über schlechte Gewinne beklagen. Es gibt bekanntlich keine zeitnahen Gewinnstatistiken, aber die Reihe „Betriebsüberschuss/Selbstständigeneinkommen“ in den saisonbereinigten Wirtschaftszahlen der Bundesbank liefert einen Anhaltspunkt. Sie wies im vergangenen Quartal eine Zuwachsrate von 5,9 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2010 auf, was auch nach Abzug der Inflationsrate einen starken Anstieg darstellt. Die Rekordergebnisse von Mitte 2008 sind fast wieder erreicht.
Aber auch die Verbraucher haben sich zuletzt aus der Deckung getraut und erstmals seit Menschengedenken wieder den entscheidenden Wachstumsbeitrag geleistet – der private Konsum war im dritten Quartal real mit einer annualierten Rate von 3,3 Prozent gestiegen, nach einem Rückgang von 2,4 Prozent im zweiten Quartal! Angesichts einer Sparquote von 11,0 Prozent, einer Zuwachsrate des verfügbaren Einkommens von 3,1 Prozent im Vorjahresvergleich und dem anhaltenden und geradezu sensationellen Anstieg der Beschäftigung (zuletzt 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr) gibt es da allerdings noch eine Menge Nachfragepotenzial. In kaum einem Industrieland ist der Anteil des privaten Konsums am BIP so niedrig wie in der Bundesrepublik (57,2 Prozent).
Sogar der Staat war diesmal weniger knauserig als sonst. Da die Konjunktur bisher mit sprudelnden Steuereinnahmen einherging und die Haushaltsdefizite daher geringer ausfielen als gedacht, steigerte er seine Konsumausgaben (vorwiegend Löhne und Gehälter) real annualisiert mit einer Rate von 2,2 Prozent; in den vergangenen fünf Jahren waren es im Durchschnitt nur 1,7 Prozent. Eine Politik, die auch in einer tiefen Rezession wie der von 2008/2009 nicht zusätzlich auf die Bremse trat und damit einen Anstieg der Budgetdefizite hinnahm, hatte auf erfreuliche Weise die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert, ebenso wie die Erwartung, dass es bald wieder besser werden würde.
Die Stärke der Nachfrage hat die Unternehmen im dritten Quartal offenbar überrascht. Sie übertraf die Produktion deutlich, so dass es zu einem Abbau der Lagerbestände kam. Für sich genommen bewirkte dieser Effekt gegenüber dem zweiten Quartal einen Rückgang des realen BIP um 0,4 Prozentpunkte. Mit anderen Worten, hätte die Produktion unmittelbar auf die Nachfrage reagiert, wäre das reale BIP im dritten Quartal nicht mit einer annualisierten Rate von 2,1 Prozent, sondern von 3,6 Prozent gestiegen. Der Lagerabbau hat eine erfreuliche Seite: Er wird verhindern, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion im jetzigen (vierten) Quartal zu stark zurückgeht – die Läger müssen ja wieder aufgefüllt werden!
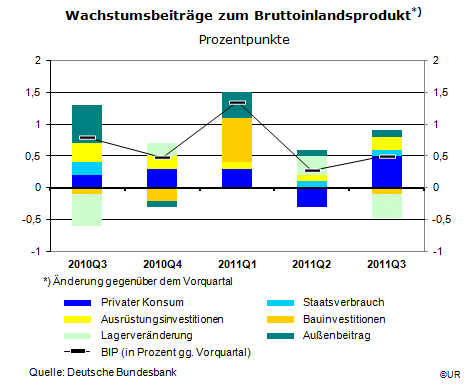
Von der bis zuletzt anhaltenden Ausgabenfreude der Inländer haben die Ausländer sehr profitiert: Das Volumen der Einfuhren expandierte sogar etwas rascher als das der Ausfuhren. Deutschland betreibt keineswegs eine Wachstumspolitik auf Kosten der Handelspartner, obwohl der große positive Außenbeitrag (von 5,3 Prozent des BIP in Q3) das auf den ersten Blick vermuten lassen könnte. Einfuhren und Ausfuhren nehmen seit Jahren im Gleichschritt zu (real um jeweils etwa fünf Prozent pro Jahr) – und viermal rascher als das reale BIP. Auf’s Ganze gesehen ist Globalisierung bisher kein Schreckgespenst.
Und die Inflation? Wie steht es um die Kaufkraft des „deutschen“ Euro? Auch hier gibt es nichts zu meckern, finde ich. Im November betrug die Inflationsrate der Verbraucherpreise zwar noch 2,4 Prozent im Vorjahresvergleich, die Tendenz ist aber wegen der sinkenden Rohstoffpreise und der schwächeren gesamtwirtschaftlichen Nachfrage rückläufig, so dass die „kritische“ Marke von 2 Prozent schon bald unterschritten werden dürfte. Das breiteste Inflationsmaß, der Deflator des Bruttoinlandsprodukts, lag im dritten Quartal nur um 0,9 Prozent über seinem Vorjahreswert. Seit Einführung des Euro, also gegenüber dem vierten Quartal 1998, ist dieser Deflator im Durchschnitt um 0,7 Prozent pro Jahr gestiegen. Gemessen an der inländischen Kaufkraft war der Euro also bisher superfest. Das wird auch so bleiben, selbst wenn die EZB jetzt schon für über 200 Milliarden Euro Staatsanleihen in ihre Bücher genommen hat.