In der Londoner Wochenzeitschrift Financial News, die von der Dow Jones-Gruppe herausgegeben wird, gab es in der Ausgabe vom 16. – 22. Juli einen bemerkenswerten Artikel (Is it time to ring-fence investment banks from themselves?) von William Wright über die nach wie vor weitverbreiteten Interessenkonflikte bei Investmentbanken. Deren gewaltige Gewinne haben nicht zuletzt damit zu tun, dass sie Geschäfte betreiben, die bei genauerem Hinsehen auf Kosten ihrer Kunden und der Allgemeinheit gehen und sich vielfach an der Grenze der Legalität befinden.
Ein immer größerer und erstaunlich stabiler Teil dieser Gewinne wird durch Eigenhandel und market making (die Bereitstellung von Liquidität in den verschiedenen Marktsegmenten) erzielt. Bei JP Morgan, dem Wertpapierbereich von Morgan Stanley sowie bei Goldman Sachs, um nur drei repräsentative Beispiele zu nennen, resultierten 2011 zwischen 68 und 78 Prozent der gesamten Erträge aus diesen Aktivitäten. Das reine Kommissionsgeschäft im Auftrag von Kunden spielt eine zunehmend geringe Rolle.
Ohne eine Vermischung von Eigeninteresse und Kundeninteresse sowie ohne die Informationsvorteile, die sich aus der Größe dieser Institute ergeben, wären die Spekulationsgewinne kaum möglich. Weil die Banker wissen, was die Kunden vorhaben und wie sie sich im Markt positioniert haben, können sie entweder Trittbrettfahrer spielen, oder bei Bedarf Gegenpositionen aufbauen. Das eigene Interesse und das Kundeninteresse vermischen sich zwangsläufig, unter dem Strich aber zum Vorteil der Investmentbanken. Die Praxis habe sich so eingeschliffen, dass es an Unrechtsbewusstsein fehle – das gelte auch für die überforderten und schlecht bezahlten Bankenaufseher.
Wright empfiehlt, dass die Behörden die Aktivitäten dieser Häuser mal genauer unter die Lupe nehmen. Eine neue Version des Glass-Steagall-Acts, also die Abtrennung des Geschäfts mit Haushalten und kleinen Unternehmen vom Investmentbanking, oder das Aufbrechen von Universalbanken, reiche nicht aus, um das Unwesen zu beseitigen, das sich innerhalb des Investmentbanking selbst breitgemacht hat. Chinese Walls, mit denen Interessenkonflikte vermieden werden sollen, seien für die Zyniker in diesen Instituten de facto nur dünne Paravents. Auch Compliance-Abteilungen können sich nicht gegenüber dem dominierenden Gewinnstreben der Händler, Salesleute und Vorstände durchsetzen.
So ist es – spätestens in der Spitze der Institute sammeln sich zudem alle Informationen und können zugunsten der Aktionäre und der Mitarbeiter genutzt werden, deren Einkommen von ihren Gewinnbeiträgen und dem Aktienkurs abhängen.
Der LIBOR-Skandal, bei dem es letztlich um Preisabsprachen geht, sei kein Einzelfall. Wright wäre nicht überrascht, wenn Ähnliches beim täglichen Fixing der Swapsätze, der Kurse für britische Staatsanleihen oder des Goldpreises, gängige Praxis wäre. Auch überall dort, wo es an den Finanzmärkten Auktionen gibt, dürften sich die Banken in Kenntnis der Gebote, die sie selbst in eigenem und fremdem Namen abgeben wollen, im Voraus zu ihrem eigenen Vorteil positionieren. Spekulieren ist schön und gut, besser aber ist es, wenn man Preise selbst bestimmen kann.
Bei Aktienemissionen gehe es vermutlich ebenfalls nicht immer mit rechten Dingen zu: Während die eigentlichen Investmentbanker der Institute den Emissionskurs und die Verteilung der Papiere auf die einzelnen Kundengruppen so festzulegen versuchen, dass sich ein aktiver Sekundärmarkt entwickeln kann, geht es den Aktienhändlern und dem Salespersonal der Banken um die bevorzugte Bedienung von Hedgefonds und Hochfrequenzhändlern – als Belohnung für die guten Geschäfte in der Vergangenheit und als Anreiz für hohe Umsätze in der Zukunft. Diese Spekulanten sind in der Regel nicht daran interessiert, die Papiere für längere Zeit zu halten, sondern wollen so schnell es geht Kursgewinne realisieren.
Der Einbruch der Facebook-Aktie hat in den vergangenen Wochen wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, wie weit die Interessen der Emissionsführer auf der einen Seite und der normalen Sparer und der langfristig orientierten institutionellen Anleger auf der anderen Seite auseinander liegen.
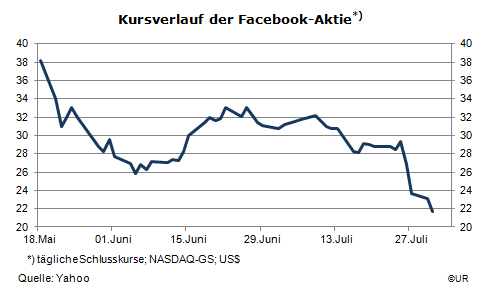
Es gebe weiterhin einen Interessenkonflikt zwischen den Abteilungen, die bei Aktienemissionen die Federführung haben und für die Emittenten einen möglichst hohen Kurs erzielen möchten, und den Aktienanalysten, deren Ruf davon abhängt, dass sie einen korrekten Emissionskurs berechnen. Es sei zudem nach wie vor wohl üblich, dass Analysten bevorzugte Kunden und Händler im eigenen Haus im Voraus informieren, wenn sie ihre Bewertungen ändern (und damit Kursbewegungen auslösen). Das gelte wohl auch für die Bereiche Festverzinsliche, Devisenhandel und Rohstoffe.
Es sei auch an der Zeit, einmal der Frage nachzugehen, warum die Gebührenstrukturen im Investmentbanking wie in Stein gemeißelt seien und warum de facto kein Preiswettbewerb stattfinde (das erinnert mich an die deutschen Immobilienmakler). Ich kann nur zustimmen und finde, das wäre ein lohnender Fall für Anti-Trust-Behörden, nicht zuletzt auch die in Brüssel.
Am profitabelsten sei für die Investmenthäuser wahrscheinlich die Zusammenarbeit zwischen Kundenbetreuern und Händlern, auch wenn diese beiden Abteilungen heutzutage nicht mehr wie in guten alten Zeiten Tür an Tür sitzen. Im Durchschnitt hängen sich die Händler, so Wright, mit einem dreimal so hohen eigenen Betrag an einen Kundenauftrag – da sie wissen, wie der Markt auf die Order reagieren wird, können sie das für sich selbst nutzen. Je größer die Bank, desto umfangreicher ist ihr Wissen über die sogenannten Flows, also das, was sich an der Schnittstelle zwischen dem Bankensektor und dem Rest der Wirtschaft tut. Es ist Gold wert, wenn man als Bank darüber informiert ist, was Versicherungen, Pensionskassen, Staatsfonds (Sovereign Wealth Funds), multinationale Firmen und große Hedgefonds vorhaben.
Im Verlauf der Finanzkrise ist es zu einer Konsolidierung im Investmentbanking gekommen, so dass die überlebenden Häuser über noch mehr Kundeninformationen verfügen als vorher.
Interessenkonflikte so weit das Auge reicht. Sehr drastisch ist das dem Publikum im Verlauf dieser Finanzkrise auch bei den strukturierten Produkten vor Augen geführt worden: Eine Bank wie Goldman Sachs hat nicht nur Schrottpapiere gebündelt und daraus nach den Regeln der Finanzalchemie neue und von den Rating-Agenturen als solide bewertete Asset Backed Securities gemacht, an den Markt gebracht und dafür Gebühren kassiert, sie hat gleichzeitig ihren besten Kunden empfohlen, diese neuen Konstrukte im Voraus per Termin zu verkaufen. Nicht auszuschließen, dass die eigenen Handelsabteilungen das ebenfalls getan haben. Die Investmentbank war stets auf der Gewinnerseite.
Im Detail sind all diese Dinge, die Wright auflistet, längst bekannt, aber es ist immer wieder nützlich, sich vor Augen zuhalten, wie sich eine relativ kleine Gruppe von Instituten auf Kosten ihrer Kunden maßlos bereichern kann. Investmentbanken sind Hedgefonds hoch zwei, weil sie nicht nur auf eigenes Risiko spekulieren, sondern Kundeninformationen, im Grunde also Insiderwissen, für ihre eigene Positionierung nutzen und zudem, anders als die NullAchtFünfzehn-Hedgefonds, im Zweifelsfall von den Steuerzahlern gerettet werden. Das darf nicht so weitergehen.
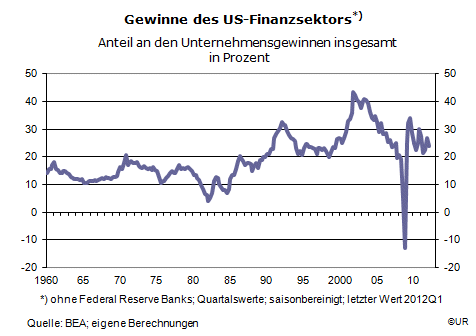
Zum Schluss noch einmal eine aktualisierte Graphik, die ich in
einem früheren Blog-Beitrag verwendet hatte: Sie zeigt, dass in den USA auch heute noch der Anteil der Gewinne des Finanzsektors an den gesamten Gewinnen bei etwa 25 Prozent liegt, bei einem Anteil an der gesamten Beschäftigung von lediglich 4,3 Prozent. Wenn es die Zahlen für den Sektor Investmentbanking separat gäbe, wäre der Unterschied noch viel größer, da bin ich mir sicher. Insgesamt haben wir es hier mit einer Perversion der Marktwirtschaft zu tun.