Es lässt sich etwas dagegen unternehmen. Grundsätzlich fehlt es nämlich nicht an Mitteln – netto ist die Währungsunion ja nicht in Fremdwährung verschuldet und daher nicht durch ausländische Gläubiger in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt. Was fehlt, ist der politische Wille, eine korrekte Analyse der Situation, der Mut zu ungewöhnlichen Maßnahmen und nicht zuletzt das Bewusstsein, dass die Länder des Euro-Raums mittlerweile eine Schicksalsgemeinschaft geworden sind.
Man muss sich nur einmal vor Augen halten, wie groß der jährliche Verlust an potenziellem Wohlstand ist. Er entsteht dadurch, dass die Kapazitäten am Arbeitsmarkt und in der Produktion nicht voll ausgelastet sind. Die erste der beiden folgenden Grafiken zeigt, wie weit das aktuelle Bruttoinlandsprodukt Eurolands unterhalb seiner Trendlinie liegt, die sich durch Extrapolation der durchschnittlichen Zuwachsraten im Zeitraum 2001 bis zum ersten Quartal 2008 ergibt – nämlich von 1,9 Prozent jährlich. Die sogenannte Outputlücke beträgt zurzeit rund 10 Prozent. Und das entspricht einer Unterauslastung von 950 Milliarden Euro.
Da es auch in diesem Jahr zu einem Rückgang des realen Bruttosozialprodukts kommen dürfte, nimmt der Verlust an potenziellem Output weiter zu und wird, wenn nichts geschieht, deutlich über einer Billion Euro liegen – und das in einem einzigen Jahr! Angesichts solcher Beträge verblassen alle europäischen Rettungspakete, die bisher diskutiert und beschlossen wurden. Mit anderen Worten, es müsste eigentlich möglich sein, alle denkbaren Kosten, die bei der Stabilisierung der Banken und der Staatsfinanzen anfallen können, durch die Einkommen aus einer besseren Kapazitätsauslastung abzudecken.
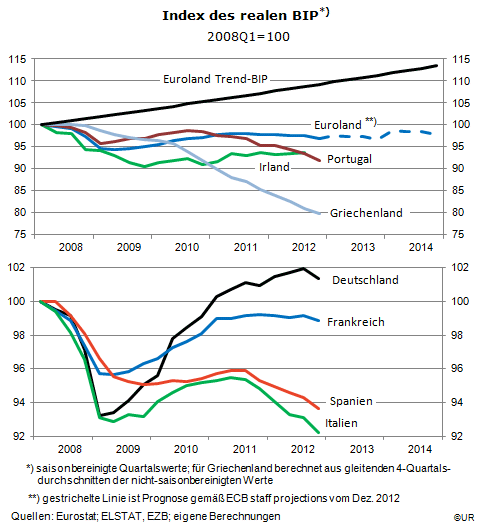
Die Sache ist nicht zuletzt deshalb dringend, weil der Produktionsapparat rasch veraltet, wenn nicht ständig neu investiert wird. Ohne Wachstum fällt der notwendige Strukturwandel schwer – wohin mit den vielen Leuten, die in der Bauwirtschaft und im Finanzsektor freigesetzt wurden? Es ist ein Teufelskreis. Weil sie kein reguläres Einkommen haben, halten sie sich mit Käufen zurück, was wiederum die Rezession vertieft. Gegenmaßnahmen sind auch deshalb dringend nötig, weil Arbeitslose ihre beruflichen Qualifikationen verlieren, wenn sie länger ohne Job sind, was dann über die Zeit den Rückgang der Arbeitslosigkeit unter sonst gleichen Bedingungen erschwert (das wird von Volkswirten „Hysteresis“ genannt). Die nächsten beiden Schaubilder zeigen, wie stark die Beschäftigung und die Anzahl der Arbeitsstunden im Euroland und seinen vier großen Ländern eingebrochen ist. In Spanien ist die Lage besonders dramatisch, ohne dass es Anzeichen für eine Wende gibt.
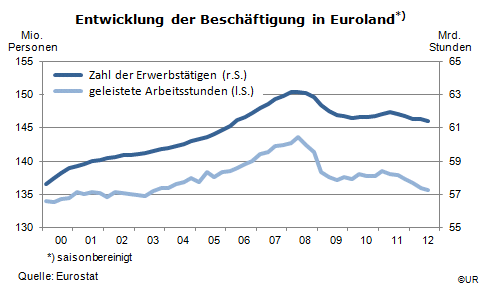
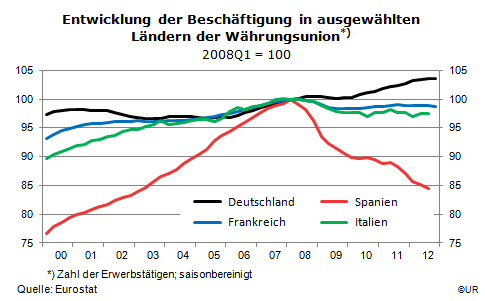
Bereits jetzt dürfte das Potenzialwachstum um Einiges niedriger sein als in den zehn Jahren bis Anfang 2008. Es drohen japanische Verhältnisse: Dort hat sich das Potenzialwachstum seit den achtziger Jahren von rund vier Prozent auf inzwischen weniger als ein Prozent verlangsamt, weil es bis heute nicht gelungen ist, die Finanzkrise zu beenden: Inzwischen werden mickrige Wachstumsraten als normal angesehen.
Warum kommt die Konjunktur Eurolands nicht ins Laufen? Die EZB erwartet laut ihrem Dezemberbericht für dieses Jahr einen Rückgang des realen BIP von 0,3 Prozent, und im „Aufschwungsjahr“ 2014 eine positive Zuwachsrate von gerade einmal 1,2 Prozent. Immerhin sinkt angesichts solcher Werte die Inflation von zuletzt zwei Prozent im Vorjahresvergleich auf durchschnittlich 1,6 und 1,4 Prozent in diesem und im nächsten Jahr. Nur für die Sparer ist das erfreulich, für Kreditnachfrage, Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen wäre es besser, wenn mit steigenden Inflationsraten gerechnet werden könnte.
Der Stab der EZB, von dem diese Prognosen stammen, geht dabei von den folgenden Annahmen aus:
- der 3-Monats-Euribor, der wichtigste Geldmarktsatz, wird bis auf Weiteres zwischen 0,2 und 0,3 Prozent verharren – er liegt heute bei 0,22 Prozent;
- die durchschnittliche Rendite 10-jähriger Staatsanleihen steigt minimal von 3,6 Prozent in diesem auf 4,0 Prozent im nächsten Jahr (das entspricht den Markterwartungen von Ende November)
- die Kreditzinsen für Haushalte und Unternehmen erreichen im Verlauf dieses Jahres ihren Tiefpunkt, steigen dann leicht
- die Kreditvergabe belastet 2013 noch die Konjunktur, dürfte aber ab 2014 neutral wirken
- die Finanzmarktkrise eskaliert nicht weiter
- in der Finanzpolitik halten sich die 17 Regierungen an ihre Pläne (verfolgen also eine restriktive Politik)
- ein Fass Erdöl der Sorte Brent kostet in diesem Jahr durchschnittlich 105 Dollar, und 100,5 Dollar im nächsten, bleibt demnach zwar hoch, sinkt aber deutlich
- die anderen Rohstoffpreise sinken 2013 leicht, steigen dann 2014 wieder um 3,3 Prozent
- der Euro kostet durchgängig 1,28 Dollar (das ist der Kurs von Ende November 2012)
- der effektive (nominale) Wechselkurs des Euro bleibt unverändert, nachdem er 2012 um 5,5 Prozent gefallen war
- das reale BIP im Rest der Welt nimmt kräftig zu: 2013 um 3,8 und 2014 um 4,5 Prozent
Insgesamt ergibt das ein Bild de facto stagnierender, wenn nicht sogar rückläufiger Inlandsnachfrage. Das ist nicht verwunderlich angesichts einer Arbeitslosenquote von fast 12 Prozent – Tendenz steigend -, überschuldeter Haushalte in den Ländern, in denen Immobilienblasen geplatzt sind, anhaltender Bilanzprobleme im Bankensektor und dem Bestreben der Regierungen, mitten in dieser tiefen Rezession ihre Budgetdefizite zu verringern. Alles, was an Dynamik zu erkennen ist, kommt von außen. Gut, dass es die Schwellenländer gibt. Aus den obigen Annahmen errechnet sich zwangsläufig das folgende Tableau aus dem Monatsbericht vom vergangenen Dezember. Besonders beunruhigend, aber nicht überraschend, ist der anhaltende Rückgang der Sachinvestitionen. Die EZB nimmt das alles auf fast fatalistische Weise hin.
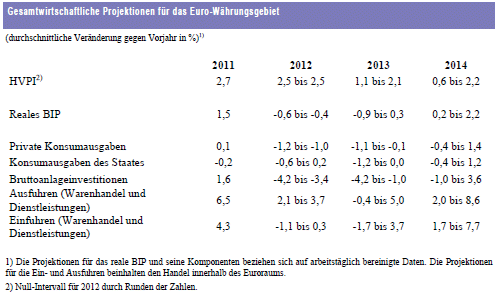
Damit das Wachstum wieder in Gang kommt, muss die Wirtschaftspolitik zum einen dafür sorgen, dass der Bankensektor nachhaltig saniert wird, zum anderen muss die große Lücke zwischen aktueller Nachfrage und Produktionspotenzial soweit es geht geschlossen werden.
Warum ist es so wichtig, dass die Banken wieder auf die Beine kommen? Die Aktivseiten ihrer Bilanzen sind voll von faulen Krediten und überbewerteten Wertpapieren (das sind vor allem Hypotheken, Anleihen staatlicher Schuldner und Asset Backed Securities). Da diese Aktiva teilweise mit weit überhöhten Ansätzen in den Büchern stehen, besteht nach wie vor ein gewaltiger Abschreibungsbedarf. Die Nullzinspolitik der EZB ist nicht zuletzt darauf gerichtet, den Zinsertrag der Banken und damit deren Gewinne zu steigern. Das erhöht ihren Spielraum für Abschreibungen. Es kann aber noch einige Jahre dauern – vielleicht sogar Jahrzehnte, wenn es so kommt wie in Japan – bis der Prozess abgeschlossen ist und alle Wertansätze auf der Aktivseite den wahren Marktpreisen entsprechen. Im Verlauf dieses Prozesses haben die Banken kaum einen Anreiz, neue Kredite zu vergeben – sie scheuen neue Risiken.
Der Knoten lässt sich nur durchschlagen, indem die neue europäische Aufsichtsbehörde die Banken zwingt, ihre sämtlichen Aktiva innerhalb kürzester Zeit marktgerecht zu bewerten. Wer das finanziell nicht verkraftet und in Konkurs zu gehen droht, muss unter die Fittiche der noch zu etablierenden Sanierungs- und Abwicklungsbehörde der Währungsunion genommen werden. Das führt zu vorübergehenden Verstaatlichungen und zwangsläufig auch zu einer weiteren Schrumpfkur des europäischen Bankensektors. Ich bin überzeugt, dass es bei den Banken noch erhebliche Produktivitätsreserven gibt, sodass deren Kunden nicht mit Nachteilen zu rechnen haben.
Das Ganze ist sehr teuer. Ich denke, dass es um mindestens eine Billion Euro geht, also etwa 10 Prozent des gemeinsamen BIP. Die Operation müsste de facto über die Notenpresse der EZB laufen – deren Bilanz sich entsprechend verschlechtern würde. Der Steuerzahler wäre aber nicht unmittelbar betroffen. Niemand muss im Übrigen befürchten, dass die Inflation dadurch aus dem Ruder läuft: Dafür sind Arbeitslosenquoten und Outputlücken viel zu groß. Die überlebenden Banken aber wären gesund und könnten sich unbelastet von Altlasten ihren eigentlichen Geschäften widmen – zwischen Sparern und Schuldnern zu vermitteln und Unternehmungen zu finanzieren, um so dazu beizutragen, dass wieder mehr investiert wird und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Der andere wichtige Ansatzpunkt bei dem Projekt, die Wirtschaft nachhaltig anzukurbeln, ist die Nachfrage. Dabei geht es vor allem um die Finanzpolitik. Von der Lohnpolitik ist angesichts der Lage am Arbeitsmarkt nicht viel zu erwarten, obwohl es helfen würde, wenn flächendeckend auskömmliche Mindestlöhne eingeführt würden – arme Leute haben meistens keine andere Wahl, als ihr gesamtes Einkommen für den Konsum auszugeben. In immer mehr Studien wird gezeigt, dass die positiven Effekte einer Lohnuntergrenze überwiegen. Die Geldpolitik halte ich für mehr oder weniger ausgereizt: Negativzinsen wären nicht schlecht, sind aber tabu und daher kein Thema.
In der Finanzpolitik gibt es dagegen größere Spielräume als allgemein vermutet. Die größten existieren natürlich in Gläubigerländern wie Deutschland, Österreich, Finnland und den Niederlanden. Da in letzter Zeit so wenig investiert wurde, sind vor allem solche Ausgaben und Steueranreize angesagt, die die Zukunftsfähigkeit der Volkswirtschaft verbessern. Ich denke an die Förderung von Kitas, Kindergärten, Schulen, Hochschulen, der dualen Ausbildung, an Forschung und Entwicklung oder die Energiewende, an Ausgaben für die Infrastruktur oder die Integration der Ausländer. Wenn wir die Grenzen offen halten und so von der internationalen Arbeitsteilung profitieren möchten, muss der Strukturwandel aktiv vom Staat begleitet werden. Das trägt entscheidend dazu bei, dass auch künftig die Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, für die es auf dem Weltmarkt einen Bedarf gibt.
In den Krisenländern der europäischen Peripherie muss der Strukturwandel noch dringender vorangetrieben werden. Es müssen Alternativen zu den Aktivitäten im Bau und in der Finanzwirtschaft entwickelt werden. Da die Zinsen, die diese Länder heute zu zahlen haben, ihre Leistungskraft übersteigen, muss die europäische Solidargemeinschaft dafür sorgen, dass sie an billige Kredite kommen – und dass die Laufzeit der existierenden Schulden verlängert wird. Das kann und wird mit Auflagen einhergehen, die die Struktur ihrer Wirtschaft in vielerlei Hinsicht verbessern und dafür sorgen, dass es so schnell nicht wieder zu faktischen Zahlungsausfällen kommt. Stichworte sind hier: effizientere Steuersysteme, höhere Steuerquoten, flexiblere Arbeitsmärkte, Privatisierungen, Abbau von Monopolen, vor allem bei den Dienstleistungen, Kampf gegen die Korruption und Steuerflucht, und was der guten Dinge mehr sind.
Insgesamt plädiere ich für eine expansivere Finanzpolitik. Obwohl sie verbunden sein sollte mit einer ehrgeizigen Strukturpolitik, wird es zunächst zu steigenden Staatsschulden kommen. Das gilt sowohl für die Gläubiger- als auch für die Schuldnerländer. Es geht leider nicht anders, da der private Sektor in eine Art Todesstarre verfallen ist und Angst hat, Geld auszugeben. Ich bin mir sicher, dass das auf viele Jahre hinaus nicht zu deutlich steigenden Realzinsen für Regierungsanleihen führt. Da ist im Übrigen auch die EZB dagegen, die keine Anstalten macht, die kurzen Zinsen zu erhöhen.
Die Beispiele Japans, der USA und Großbritanniens zeigen, dass sehr hohe Staatsschulden einhergehen können mit niedrigen und sogar sinkenden Realzinsen. Warum? Weil hohe Schulden ein Zeichen dafür sind, dass der Staat mit seiner Nachfrage versucht, einen Teil der Outputlücke zu schließen. Die Schulden der Staaten sind nicht deshalb hoch, weil leichtfertig Geld zum Fenster hinausgeworfen wurde, sondern weil die Regierungen die Folgen der Exzesse im privaten Sektor kompensieren mussten – und noch müssen. Wenn sich eines Tages neue Inflationsspiralen bilden sollten, muss natürlich gegengesteuert werden. Das ist aber für‘s erste kein Thema.