Endlich haben wir die Wahlen hinter uns und es ist wieder möglich, unvoreingenommen die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen anzugehen: die Zukunft des Euro, die Energiewende und die Einkommensverteilung. Martin Wolf hat am Mittwoch in der Financial Times wieder einmal versucht nachzuweisen, dass der Euro nicht überleben kann, wenn Deutschland an seiner Sparpolitik festhält und die Krisenländer zwingt, ebenfalls eine solche Politik zu betreiben („Germany’s strange parallel universe„). Er weist darauf hin, dass Wolfgang Schäuble vor ein paar Tagen auf der Kommentarseite der FT in seinem Beitrag („Ignore the doom-mongers – Europe is being fixed„) über die positiven Tendenzen im Euro-Land mit keinem Wort konzediert hat, dass es nicht nur auf strukturelle Reformen auf der Angebotsseite ankommt, sondern ebenso sehr auf eine dynamischere Nachfrage, wenn der Euro eine Zukunft haben soll.
Vielleicht können sich Italien, Spanien, Griechenland, Portugal und Irland durch Massenentlassungen und damit durch Produktivitätsgewinne, durch reale Abwertungen, also relativ sinkende Löhne, und durch die Reform ihrer Institutionen (Finanzverwaltung, Ausbildung, Arbeitsmarkt) gewissermaßen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, aber das ist in jedem Fall ein sehr langwieriger Prozess, und zudem einer mit ungewissem Ausgang.
Der Euro könnte angesichts der Depressionen in den Krisenländern auf der Strecke bleiben, nicht nur weil deren Staatsschulden nach wie vor steigen und ein gefährliches Niveau erreicht haben, sondern weil dort zwischen 12 und 28 Prozent der Leute arbeitslos sind, ohne dass Besserung in Sicht ist. Vor allem die Jungen sind betroffen. Insgesamt haben wir es mit einer sozialen Katastrophe zu tun.
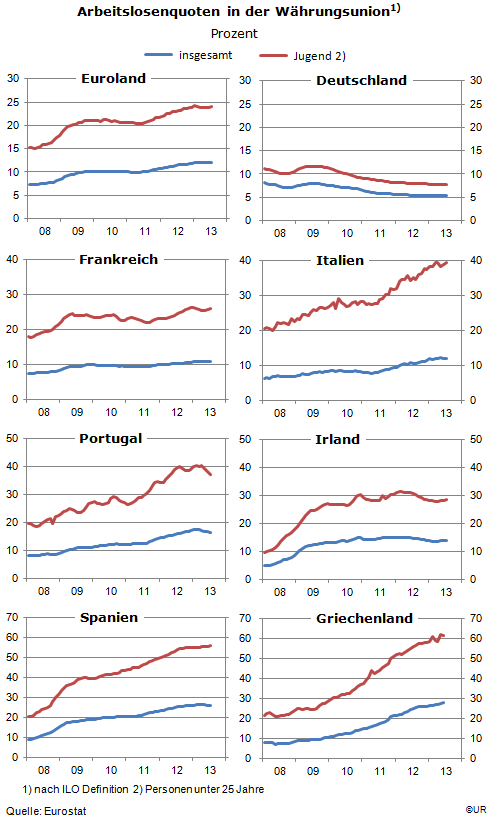
Die enorme Unterauslastung des Produktionspotenzials, gemessen an der Lücke zwischen der Trendlinie und dem aktuellen BIP Euro-Lands, oder an der Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, bedeutet, dass sich die Regierungen daran machen müssen, mindestens einen Teil der Nachfragelücke zu füllen. Jedenfalls ist ein aggregiertes Budgetdefizit von 2,9 Prozent des Euro-Land-BIP, wie es zurzeit für 2013 erwartet wird, „konjunkturbereinigt“ ein gewaltiger Überschuss. Die Finanzpolitik ist also extrem pro-zyklisch. Das muss nicht sein, das sollte nicht sein.
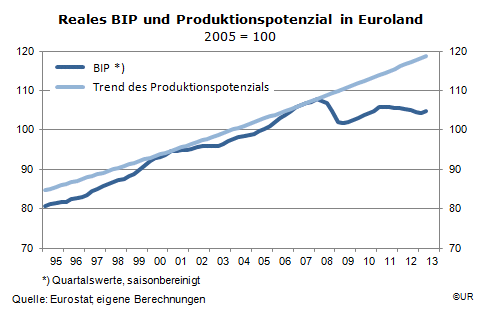
Ich sehe ja ein, dass es in den Mittelmeerländern nur dann zu den nötigen strukturellen Reformen kommt, wenn sie gar nicht anders können, aber es gibt eine Grenze. Ich halte sie für erreicht. Vor allem die neue deutsche Regierung wird in der Pflicht sein, die Anstrengungen zu honorieren, die bereits unternommen wurden. Sie schlagen sich darin nieder, dass Euroland in diesem Jahr einen Leistungsbilanzüberschuss von etwa 300 Mrd. Euro erzielen wird – weltweit der mit Abstand größte –, dass die Defizite in den Staatshaushalten rapide abgenommen haben und dass eine jahrelange Depression akzeptiert wird, nur um die harten Auflagen des Maastricht-Vertrags zu erfüllen und den Euro zu behalten.
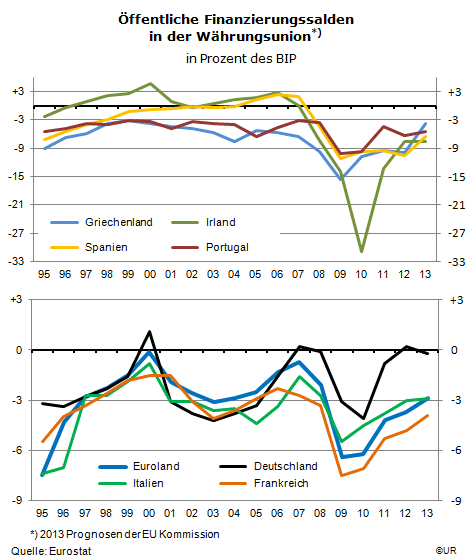
Es kann nicht darum gehen, jetzt wieder den Wohnungsbau zu stimulieren. Der Überhang an unverkauften Immobilien verbietet das (wenn auch nicht in Deutschland). Das beste Konjunkturprogramm ist eines, das nicht nur kurzfristig Nachfrage schafft, sondern gleichzeitig dazu dient, den Kapitalstock zu modernisieren und zu vergrößern, Jugendliche und Arbeitslose auszubilden und umzuschulen und die Qualität der Umwelt zu verbessern. Das sind Ziele, auf die sich alle leicht verständigen können. Sie sind die Themen von Sonntagsreden. Warum aber passiert so wenig in dieser Richtung? Die Entschuldigung, dass erst der Ausgang der deutschen Wahlen abgewartet werden müsse, zieht jetzt nicht mehr. Offenbar ist es die Vorstellung, dass steigende staatliche Defizite des Teufels sind. Lieber schaut man zu, wie der Kapitalstock verrottet und überlässt die Jugendlichen ihrem Schicksal. Aus Angst vor dem Tod begehen die europäischen Politiker Selbstmord.
Dabei kann sich der Bund heute auf 30 Jahre zu Festzinsen von 2,7 Prozent verschulden, Frankreich zu 3,5 Prozent und die Europäische Investitionsbank zu 3,0 Prozent. Das sind im Vergleich zur Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent, die die EZB mittelfristig anstrebt, und auch im Vergleich zu den längerfristigen Wachstumsaussichten eines zunehmend integrierten europäischen Wirtschaftsraums niedrige Sätze. Die Gelegenheit sollte unbedingt für die Emission von Anleihen genutzt werden, mit denen sich zukunftsweisende – und Arbeitsplätze schaffende – nationale und supranationale Investitionen finanzieren lassen. Euro-Bonds, so wie sie der Sachverständigenrat in seinen Gutachten vorschlägt, sollten ebenfalls möglichst bald auf die Agenda kommen.
Daneben hindert die künftige Bundesregierung nur wenig daran, die europäische Bankenunion energisch voranzubringen. Da ihre Verhandlungsposition als wichtigster potenzieller Gläubiger zurzeit sehr stark ist, kann das weitgehend zu ihren Bedingungen geschehen. Eine neue Bankenkrise wäre das größte Risiko für den Euro. Daher muss der Bankensektor dringend krisenfest gemacht werden.
Im Übrigen sind die Marktteilnehmer ganz optimistisch, was die Zukunft der gemeinsamen Währung angeht – sonst wäre der Euro-Wechselkurs nicht so fest. Auch die zehnjährigen Renditen von Staatsanleihen sprechen dafür: Sie liegen in Italien bei 4,2 Prozent, in Spanien bei 4,3, in Irland bei 3,8, in Portugal bei 6,9 und in Griechenland bei 9,5 Prozent. Das sind immer noch hohe Sätze, aber sie sind inzwischen deutlich niedriger als noch vor wenigen Monaten; und sie befinden sich in einem Abwärtstrend.
Nach wie vor ist der Euro auch in der Bevölkerung im Allgemeinen sehr populär. Die Rückkehr zu nationalen Währungen steht auf den Wunschlisten durchgängig ganz unten. Das günstige Umfeld sollte genutzt werden.