Bei den europäischen Notenbankern herrscht Panik – wie sonst könnten die Chefvolkswirte der Bundesbank und, weniger überraschend, der EZB plötzlich vorschlagen, dass die deutschen Löhne stärker steigen sollten als bisher? Es sieht danach aus, als ob die Inflationsrate Euro-Lands im Juli auf 0,3 Prozent (gg. Vj.) gesunken sein könnte. Wenn es wenigstens Anzeichen dafür gäbe, dass wir vor einer Trendwende stehen. Die fehlen aber bislang.
Noch sinken im Euro-Raum die Einfuhrpreise und die industriellen Erzeugerpreise. Auf den vorgelagerten Stufen herrscht also schon längst Deflation. Angesichts einer Arbeitslosenquote von 11,6 Prozent und gewaltiger Kapazitätsreserven sind die Unternehmen nicht in der Lage, ihre Preise zu erhöhen. Im Übrigen sind sie nicht sonderlich unter Druck, das zu tun, weil sie ihre Kosten im Griff haben und weil sie Gewinner der anhaltenden Umverteilung der Einkommen zugunsten des Faktors Kapital sind. Weil der Welthandel zurzeit real mit einer Rate von rund fünf Prozent expandiert, läuft ihr Auslandsgeschäft ganz gut, der Euro ist erfreulich schwach, sodass sie sich um ihre Wettbewerbsfähigkeit keine Sorgen zu machen brauchen, die Kredite sind so billig wie nie und werden aller Voraussicht nach für eine lange Zeit so billig bleiben.
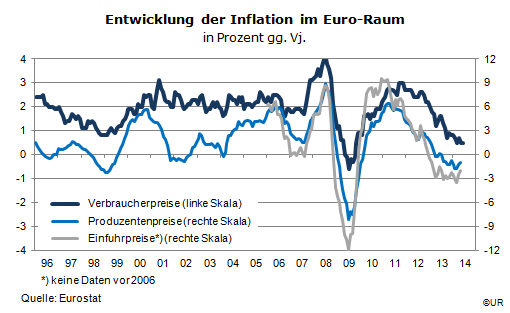
Kurzum, Deflation kann sich diesmal als ein hartnäckigeres Problem erweisen als im Jahr 2009. Wenn ich mir den Rückgang der Preise für Wohnimmobilien und gewerbliche Bauten anschaue, oder der Kredite an den privaten Nicht-Banken-Sektor Euro-Lands, kann ich nur den Schluss ziehen, dass das sogenannte Deleveraging, der forcierte Abbau von Schulden, noch längst nicht beendet ist. Schuldenabbau verträgt sich aber nicht mit einem Anstieg der Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, den es braucht, damit die Konjunktur in der Währungsunion endlich wieder in Fahrt kommt.
Gleichzeitig sind die Banken unter Druck, bis zum November die Qualität ihrer Bilanzen so zu verbessern, dass sie nicht durch die dann stattfindende Prüfung durch die EZB, der neuen Aufsichtsbehörde, fallen. Dabei geht es um 130 große oder zumindest systemrelevante Institute, auf die rund 80 Prozent der Bankenaktiva Euro-Lands entfallen, also praktisch um den Sektor als Ganzes. Gab es das schon mal – eine ultra-lockere Geldpolitik, die den Banken Notenbankgeld in unbegrenztem Umfang und zum Nulltarif hinterherwirft mit der Aufforderung, doch bitte mehr Kredite an die kleinen und mittleren Unternehmen zu vergeben (allerdings nicht an die Bauwirtschaft!), während die Banken gleichzeitig ihre Bilanzprüfung nur dann unbeschadet überstehen, wenn sie sich von einem Teil ihrer tendenziell notleidenden Kredite und Wertpapiere trennen? Das zeigt, wie vertrackt die Lage ist und wie wenig Spielraum die europäische Geldpolitik hat. Man muss es so klar sagen: Sie hat das Ende der Fahnenstange erreicht.
So ist aus dem Saulus Bundesbank, für den Lohninflation stets das Übel schlechthin war, ein Paulus geworden. Auf einmal sind höhere deutsche Löhne ein Mittel gegen die Deflation. Zweifellos wäre es wünschenswert, wenn die Arbeitnehmer mehr Geld in der Tasche hätten. Sie geben bekanntlich mehr von ihrem Zusatzeinkommen aus als die Unternehmer und andere Bezieher von Vermögenseinkommen, sodass der positive Effekt auf die Konjunktur viel stärker wäre als ein weiterer Anstieg der Gewinnquote. Das Deleveraging ist außerdem in Deutschland kein so wichtiges Thema (außer bei manchen Banken), weil der letzte kreditbefeuerte Immobilienboom schon 20 Jahre zurückliegt.
Auch aus Sicht der Unternehmen wäre es nicht schlecht, wenn die Leute endlich wieder mehr konsumieren würden. Doch obwohl die Beschäftigung seit Jahren – und bis zuletzt – mit Raten von fast einem Prozent pro Jahr zunimmt, lassen sich die Haushalte nicht aus der Reserve locken. Die Löhne steigen einfach nicht rasch genug. Würden sie, sagen wir, zwei Jahre in Folge um jeweils 3,5 Prozent zulegen, ergäbe das einen Anstieg der Arbeitnehmereinkommen von zweimal rund 4,5 Prozent. Bei einer Inflationsrate von nur einem Prozent würde real fühlbar mehr in der Lohntüte landen. Nicht alles davon würde zulasten der Gewinne gehen: Die Unternehmen verfügen nach wie vor über freie Kapazitäten und dürften damit in der Lage sein, die zusätzlichen Kosten durch Produktivitätsgewinne aufzufangen, abgesehen davon, dass die Umsätze steigen werden. Vor allem wäre das ein Startschuss für mehr Investitionen und damit für einen nachhaltigen Aufschwung. Niedrige Zinsen, ein ausgeglichener Staatshaushalt und die Erfolge der Unternehmen und Kapitalbesitzer im nationalen Verteilungskampf haben die Investitionen bisher nicht, oder nur enttäuschend wenig stimuliert. Am wichtigsten ist noch allemal die Aussicht auf steigende Umsätze. Dazu passt ein rascherer Anstieg der Arbeitseinkommen.
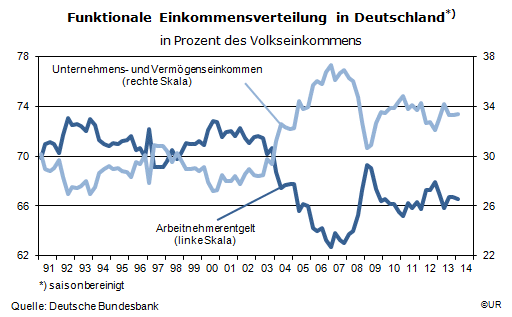
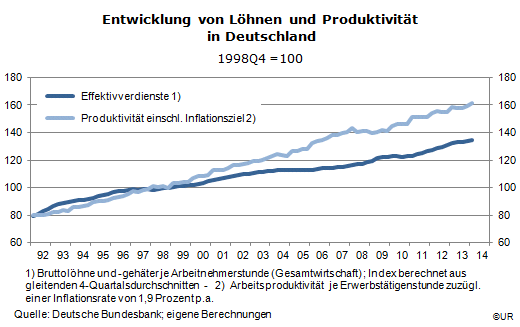
Als ich noch im Stab des Sachverständigenrats war, lang ist’s her, galt es irgendwie als normal und fair, dass die Löhne mit einer Rate steigen sollten, die sich aus dem Produkt der Zuwachsraten von mittelfristiger Produktivität und angestrebter Inflationsrate errechnete, mit Anpassungen nach unten oder oben, je nach Auslastung des Produktionspotenzials. Wie das vorhergehende Schaubild eindrucksvoll zeigt, ist von einer solchen Formel schon seit Jahren keine Rede mehr – bis vergangene Woche! Vermutlich dämmert es der Bundesbank am Ende doch, dass es irgendwie einen Zusammenhang zwischen Lohninflation und Deflationsrisiko gibt. Die europäischen Nachbarn dürften applaudieren. Sie drängen schon länger darauf, dass in Deutschland eine expansivere Einkommenspolitik betrieben wird.
Fragt sich, wie die Tarifparteien reagieren werden. Früher ging der implizite Deal immer so: Die Bundesbank würde die Zinsen nicht erhöhen, wenn die Abschlüsse mäßig blieben. Jetzt soll es in die andere Richtung gehen. Allerdings haben Bundesbank und EZB nichts in der Hand, das Arbeitgeber und Gewerkschaften in irgendeiner Weise beeindrucken könnte. Die Zinsen lassen sich nicht weiter senken und es ist darüber hinaus schon seit Langem klar, dass es auf Jahre hinaus bei Nullzinsen bleiben wird. Die Notenbanken haben bereits geliefert. Sie können lediglich hoffen, dass die deutschen Tarifparteien höhere Abschlüsse hinkriegen.
Zum Schluss noch eine Bemerkung am Rande: Ich bin gespannt, wie sich die Bundesbank demnächst zur angemessenen Finanzpolitik äußern wird. Hier im Herdentrieb argumentiere ich schon lange, dass die deutsche Outputlücke viel größer ist als die von OECD, Instituten, Bundesbank oder Sachverständigenrat berechnete. Für mich bedeutet das, dass wir es gegenwärtig konjunkturbereinigt mit einem Überschuss von vier Prozent des BIP zu tun haben, oder mehr. Ein ausgeglichener Haushalt, über den sich Minister Schäuble so freut, ist so gesehen nicht situationsgerecht – die Finanzpolitik ist pro-zyklisch und trägt damit zu den deflationären Tendenzen bei. Muss nicht sein.