Genug ist genug: Das Wirtschaftswachstum ist vor allem in der Peripherie des Eurolands seit Jahren so gering, dass dort zunehmend gefragt wird, was der Euro eigentlich bringt. Die überwiegende Mehrheit möchte den Euro zwar behalten, die euro-skeptischen Parteien aber haben starken Zulauf. Sie sind nicht für eine Abschaffung, die Regeln und Auflagen sind ihnen jedoch zu streng und sie würden sie gerne ändern. In den vergangenen sieben Jahren sind weder zusätzliche Arbeitsplätze entstanden, noch hat es einen Anstieg des allgemeinen Wohlstands gegeben. Ganz im Gegenteil, im Süden Europas, liegen die Arbeitslosenquoten immer noch zwischen 13 und 26 Prozent. Das Fatale an der Sache ist, dass die europäische Wirtschaftspolitik auf pro-zyklische Weise versucht, die angeblich gefährliche Staatsverschuldung durch forciertes Sparen statt durch Wirtschaftswachstum in den Griff zu bekommen.
Viel besser machen es seit einigen Jahren Länder wie die USA und Großbritannien, wo die Geldpolitik ähnlich expansiv ist wie die der EZB, die aber nicht durch Verträge gezwungen sind, ihre Haushaltsdefizite unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Lage zu reduzieren. Den dortigen Wirtschaftspolitikern ist klar, dass Sparen dann kontraproduktiv ist, wenn die Nachfrage gemessen an der Auslastung der Kapazitäten und der Beschäftigung schwach, die Outputlücke also groß ist und Ressourcen brach liegen. Durch Sparen Wachstum zu erzeugen hat nie funktioniert, und es wird nie funktionieren. Mehr Sparen – etwa indem Haushaltsdefizite vermindert werden – bedeutet weniger Ausgaben, weniger Aufträge an die Unternehmen, höhere Arbeitslosigkeit, weniger Investitionen und ein langsameres Wachstum. So einfach ist das. Wenn niemand Geld ausgeben will, braucht auch niemand zu arbeiten. Sparen kann für den einzelnen Haushalt sinnvoll sein, aber gesamtwirtschaftlich ist es tödlich, wenn nicht entsprechend Schulden gemacht, in Human- und Sachkapital investiert und Einkommen generiert wird.
Die folgende Grafik zeigt, mit welcher Entschlossenheit die Länder des Euroraums dem Mantra der europäischen Wirtschaftspolitik, Haushaltsdisziplin zu üben, gefolgt sind und ihre strukturellen, also konjunkturbereinigten Defizite im Verlauf der Eurokrise vermindert haben. Die USA und Großbritannien, aber natürlich auch Japan, waren in dieser Hinsicht viel entspannter. Das konnten sie nicht zuletzt deshalb sein, weil es sich um Nationalstaaten handelt, für die das Thema „Haften für die ausgabefreudigen, aber unkontrollierbaren Mitgliedsländer“ nicht relevant ist. Solidarität mit den Schuldnern im Inland ist für sie eine Selbstverständlichkeit, allerdings verbunden mit einer entsprechenden Kontrolle, was in der Währungsunion bisher so noch nicht möglich ist. Ihre Strategie bestand darin, erst einmal sehr große strukturelle Defizite hinzunehmen und dann auf Wachstum zu setzen, wodurch sich die Defizite in der Folge dann sehr rasch verringerten.
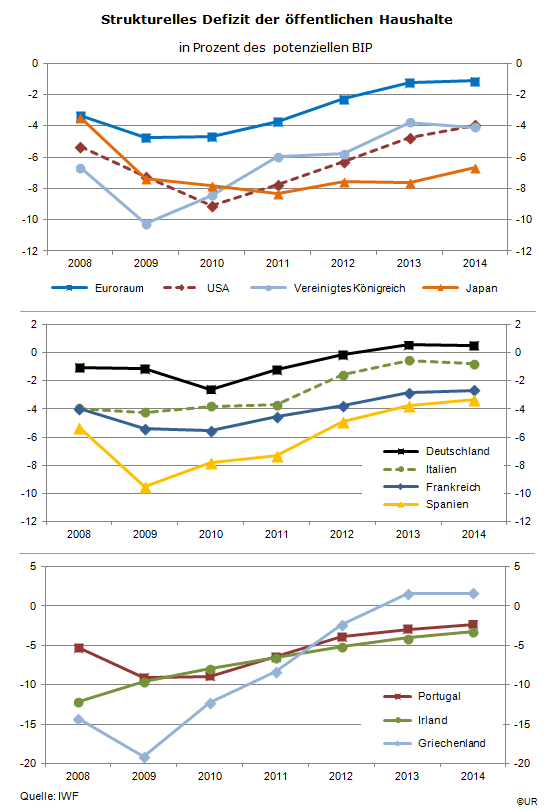
Auf mittlere Sicht ist es besonders beunruhigend, dass die Investitionen seit Beginn der Krise so stark zurückgegangen sind. Darin spiegelt sich teilweise wieder, dass es zuvor in der Peripherie einen Immobilienboom gegeben hatte, besser: eine Immobilienblase, die sich als Fehlinvestitionen erwiesen. Die Umstellung auf Investitionen in Maschinen, Anlagen und Software erweist sich offenbar als schwierig, vielleicht auch weil die richtig ausgebildeten Arbeitskräfte fehlen. Aber abgesehen von diesem Effekt lässt sich dennoch sagen, dass die Investitionen im Euroraum auf einem sehr niedrigen Niveau stagnieren, was wiederum Probleme für die Produktivität, das Produktionspotenzial und den künftigen Wohlstand bedeutet. Euroland ist der lahme Mann der Weltwirtschaft, und es verwundert nicht, dass es bei den ausländischen Direktinvestitionen keine Nettozuflüsse gibt. Auch die Euroschwäche könnte damit zusammenhängen.
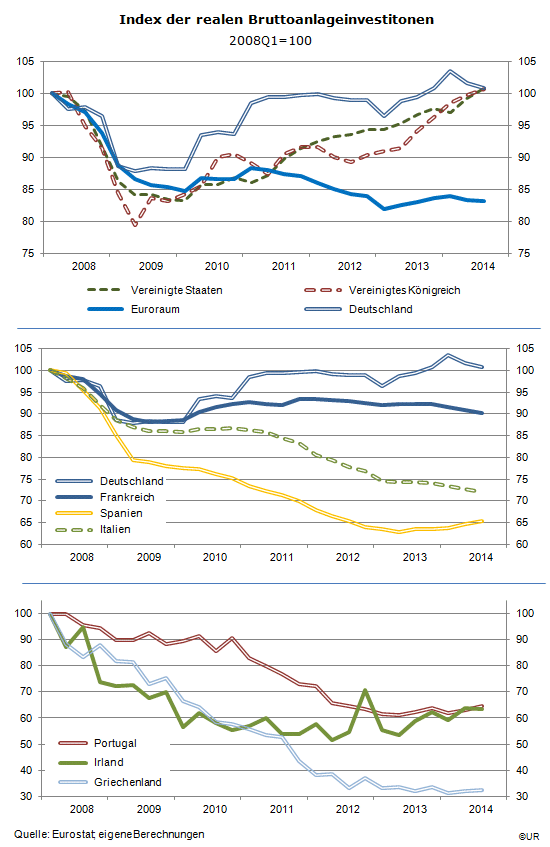
In den USA hatte es im Übrigen ebenfalls eine Immobilienblase gegeben – ihr Platzen war letztlich der Auslöser für die Große Globale Rezession der Jahre 2008 und 2009. Trotzdem kamen die Investitionen nach ihrem Einbruch seit Anfang 2010 wieder in Schwung, unterstützt von einer sehr expansiven Wirtschaftspolitik, nicht zuletzt der Finanzpolitik. Ähnlich war der Ansatz im Vereinigten Königreich, und ähnlich war auch das Ergebnis bei den Investitionen. Das hatte es im Euroland, mit seinen Maastricht-Kriterien und seinem Fiskalpakt, in dieser Form nicht gegeben.
Amerika spielt beim Wirtschaftswachstum inzwischen in einer anderen Liga als der Euroraum: Gegenüber dem ersten Quartal 2008 ist sein reales BIP bis zum dritten Quartal 2014 um fast neun Prozent gestiegen, während das BIP Eurolands noch um etwas mehr als zwei Prozent darunter lag. Besonders heftig hatte es von den großen Ländern Italien getroffen, Spanien scheint endlich auf dem Weg der Besserung zu sein. So sehr sich die deutsche Bevölkerung in Umfragen mit der wirtschaftlichen Situation zufrieden zeigt, so bescheiden sind in Wirklichkeit die Zuwachsraten beim Sozialprodukt – auf vollkommen unnötige Weise wurde bis zuletzt trotz Haushaltsüberschüssen an einer restriktiven Finanzpolitik festgehalten.
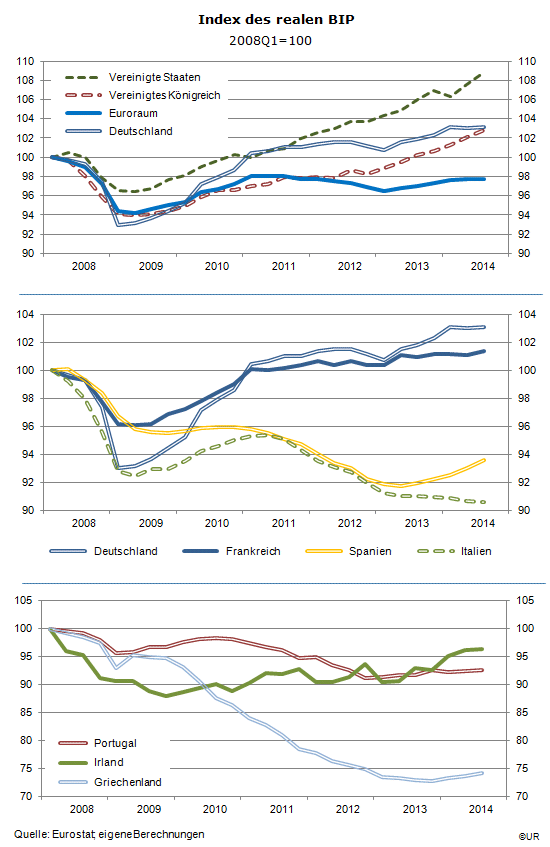
Die Spielräume, die es in Deutschland gab, wurden zu Schaden aller nicht genutzt. Unser Land ist mitverantwortlich dafür, dass Euroland immer noch in der Krise steckt und der Euro selbst immer weniger als Erfolgsmodell gilt. Am allerschlimmsten hatte es Griechenland getroffen (wo an diesem Sonntag eine neue Regierung gewählt wird) – das reale BIP ist durch die Politik des gewaltsamen Sparens und einer „internen“ Abwertung inzwischen auf den Stand von 1999 zurückgegangen, und die Arbeitslosenquote liegt bei 25,7 Prozent.