Nullzinsen, aggressives Gelddrucken durch Verlängerung der Notenbankbilanzen (Quantitative Easing), Zusicherungen durch die Geldpolitiker, dass die Leitzinsen auf Jahre hinaus nicht angehoben werden (Forward Guidance), negative Zinsen auf die Überschussreserven der Banken bei der EZB, der Riksbank, der Schweizer Nationalbank und jetzt auch der Bank von Japan. Die „unkonventionellen“ Maßnahmen wollen kein Ende nehmen. Aber sie schlagen nicht an. Das Angebot an finanziellen Mitteln für die Banken ist reichlich und billig, nur es fehlt an der Nachfrage – die Wirtschaft steckt weiterhin in einer sogenannten Liquiditätsfalle, aus der sie sich mit geldpolitischen Maßnahmen allein offenbar nicht befreien kann.
Im Euroraum ist der Output, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt, im Zeitraum 2008 bis 2015 trotz der ultraexpansiven Geldpolitik im Jahresdurchschnitt nur um 0,16 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote hat sich seit ihrem Höchstwert von 12,0 Prozent im Jahr 2013 kaum vermindert und lag 2015 immer noch bei 11,0 Prozent. In den vergangenen beiden Jahren hat die Wirtschaft zwar etwas an Fahrt aufgenommen. Aber angesichts des starken Rückenwinds durch die Euroabwertung, den Einbruch der Rohstoffpreise und die niedrigen Zinsen waren Zuwachsraten von rund 1,5 Prozent dann doch enttäuschend. Zumal jetzt schon wieder die nächste globale Rezession droht und der Instrumentenkasten der EZB de facto leer ist.
Durch die langjährige Stagnation des Outputs sind inzwischen die meisten Analysten bei der EZB, der EU-Kommission und den Wirtschaftsforschungsinstituten der Meinung, dass das „normale“ Wachstumspotenzial mittelfristig auf etwas über ein Prozent jährlich zurückgegangen ist. Zu Beginn der Währungsunion hatte es noch bei 2,25 Prozent gelegen. Es wird zu wenig investiert, mit der Folge, dass der Kapitalstock nicht mehr wächst und die Produktivität auf der Stelle tritt. Von beiden aber hängt ab, wie es unseren Kindern und den künftigen Rentnern einmal gehen wird.
Das gesamte Wachstum der letzten Zeit beruht darauf, dass mehr Arbeitsplätze entstanden sind (zurzeit nimmt die Beschäftigung mit Raten von 1,1 Prozent zu). Es wird mehr gearbeitet, aber nicht effektiver. Nicht weniger ärgerlich ist neuerdings die These, dass sich die Wirtschaft Eurolands angeblich der Vollbeschäftigung nähert: Wenn die Wachstumsraten des realen BIP tatsächlich, wie es der Internationale Währungsfonds erwartet, in den drei Jahren 2015 bis 2017 jeweils etwa 1,6 Prozent betragen, schließt sich nämlich die Outputlücke bei dem unterstellten geringen Potenzialwachstum um etwa einen halben Prozentpunkt jährlich und verschwindet damit über kurz oder lang. Dann wäre es an der Zeit, fiskalpolitisch wieder die Zügel anzuziehen. Ich übertreibe nur wenig.
Die folgende Grafik zeigt, wie groß die Produktionslücke im Euroland ist, wenn man das Potenzialwachstum nicht auf der Basis der jüngsten Vergangenheit, sondern eines längeren Zeitraums berechnet. Dann ergibt sich ein Trendwert von 1,9 Prozent pro Jahr. Das reale BIP liegt bei diesem Ansatz um nicht weniger als 13,6 Prozent unter seinem Potenzialwert. Dass sich die europäische Arbeitslosenquote in einer ähnlichen Größenordnung befindet, zeigt, dass es sich nicht um eine irgendwie aus der Luft gegriffene Zahl handelt.
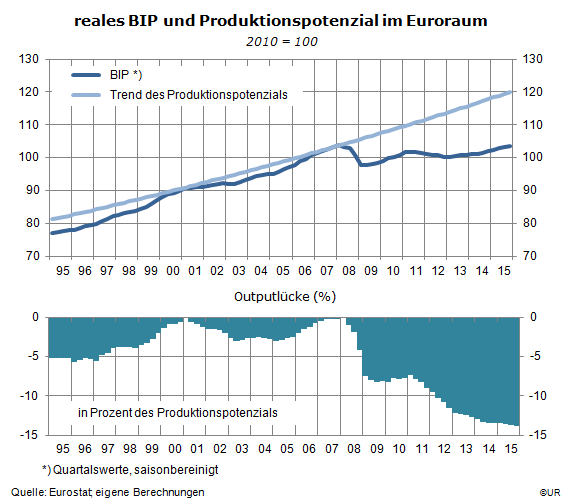
Die Wirtschaftspolitik ist, gemessen an ihren „Erfolgen“, ein einziges Desaster und es verwundert nicht, dass überall national-populistische Parteien an Boden gewinnen. Oder dass Länder wie Großbritannien, Polen, die Tschechische Republik oder Schweden nichts mit dem Euro zu tun haben wollen. Oder dass der Zustrom der Flüchtlinge uns finanziell angeblich überfordert, obwohl davon überhaupt keine Rede sein kann.
Woran liegt’s, dass die Nachfrage nach Krediten und damit die Konjunktur nicht in Gang kommen? Die einfache Antwort lautet: an den Schulden. Sie werden als zu hoch empfunden, wenn nicht sogar als existenzbedrohend. Richard Koo vom Brokerhaus Nomura hat, das Beispiel Japans vor Augen, vor vielen Jahren dafür den Begriff balance sheet recession geprägt. Die Bilanzen der privaten Haushalte und Unternehmen sind durch Überschuldung in der vorangegangenen Boomphase aus dem Lot geraten. Sie versuchen daher, durch sparsames Wirtschaften ihre Kreditwürdigkeit wiederherzustellen und geben so wenig aus, wie sie nur können. Neue Kredite nehmen sie erst recht nicht auf. Eine Rezession lässt sich geldpolitisch nicht beenden, wenn die Wirtschaftsakteure eine solche Strategie verfolgen. Diese Verkürzung des Schuldenhebels nennt sich deleveraging.
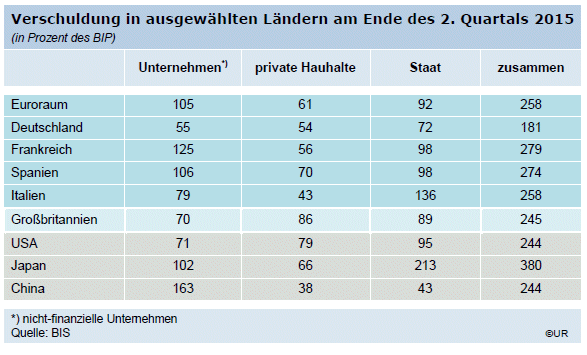
Der Prozess ist in weiten Teilen Eurolands noch im Gange, wobei Deutschland die wichtigste Ausnahme ist: Anders als in den meisten übrigen Ländern der Währungsunion war es in der Frühphase des Euro nicht zu einer Immobilienblase gekommen, weil die Realzinsen hierzulande schon immer ziemlich niedrig waren. In Spanien, Irland, Portugal, Italien und Griechenland aber waren sie von einem sehr hohen Niveau auf das deutsche und darunter gefallen und hatten so eine Verschuldungsorgie ausgelöst. Der Kater hält bis heute an.
Hinzu kam der Zwang zur Haushaltskonsolidierung durch den Maastricht-Vertrag. Weil die Mitgliedsländer der Währungsunion gehalten waren, die staatlichen Haushaltsdefizite auf drei Prozent des BIP oder weniger zu vermindern, und die Staatsschulden auf 60 Prozent des BIP, verfolgten sie im Nachgang zu den teuren Rettungsaktionen für ihre Finanzsektoren eine ausgesprochen prozyklische Finanzpolitik. Das galt bislang selbst für Deutschland, wo die öffentlichen Finanzen so gesund sind wie sonst fast nirgendwo auf der Welt.
Mit anderen Worten: Es fehlte an einem Akteur, der mit den vielen Ersparnissen etwas Produktives anfangen konnte. In gewisser Weise waren das die Schwellenländer sowie die USA und Großbritannien, wo die Aversion gegen das staatliche Schuldenmachen nicht so ausgeprägt ist wie auf unserem Kontinent. Nun ist es im Gefolge des Strukturwandels und geringeren Wirtschaftswachstums in China global zu einem Einbruch der Rohstoffpreise gekommen, der viele Schwellenländer hart getroffen hat. Kapitalflucht, Abwertungen und eine deutliche Abschwächung des Wachstums, teilweise sogar tiefe Rezessionen (Russland, Brasilien) sind die Folge.
Normalerweise hätten die Nettoimporteure von Rohstoffen von dem Preisverfall profitieren müssen – schließlich hat sich dadurch ihre Kaufkraft stark verbessert – sodass per saldo für die Weltwirtschaft ein Nachfrageschub herausgekommen wäre. Es sieht allerdings danach aus, als würde dieses „Geschenk“ zu einem großen Teil nicht zu zusätzlichen Käufen, sondern für den Abbau von Schulden verwendet. Nichts ist mehr normal, wenn die Schulden als zu hoch empfunden werden.
Wenn die Haushalte und Unternehmen des privaten Sektors weder durch eine expansive Geldpolitik noch durch einen markanten Kaufkraftgewinn durch billige Importe aus der Reserve zu locken sind und eine lange Periode niedriger Wachstumsraten á la Japan nicht infrage kommt, bleibt nur ein Ausweg aus der Liquiditätsfalle: Der Staat muss die Nachfragelücke füllen. In Japan war und ist das der Fall. Richard Koo argumentiert, dass es sonst zu einer lang anhaltenden Rezession gekommen wäre. So konnte in den vergangenen 20 Jahren immerhin noch eine durchschnittliche Zuwachsrate des realen BIP von etwas unter ein Prozent erreicht werden (vor dem Platzen der Blasen zu Beginn der neunziger Jahre lag das Trendwachstum bei über vier Prozent). Die gewaltige Zunahme der staatlichen Schulden hat übrigens weder zu einem Anstieg der Inflation noch zu einem Anstieg der Zinsen auf die staatlichen Schulden geführt. Japan ist in diesen Tagen nach der Schweiz das zweite Land, wo die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den negativen Bereich abgerutscht sind. Trotz der hohen Schulden hat die Bonität nicht gelitten.
Nicht jedes Land ist in der Lage, auf eine expansive Finanzpolitik umzuschalten. Griechenland oder Portugal können sich das nicht erlauben, auch Russland und Brasilien nicht. Sie würden von den Kapitalmärkten sofort hart bestraft. Von den großen Ländern hat keines einen so großen Spielraum wie Deutschland. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen betragen im Augenblick gerade mal 0,20 Prozent und im gesamtstaatlichen Haushalt werden trotz der Belastungen durch die Flüchtlinge Überschüsse erzielt. In absoluten Zahlen exportiert kein Land (mit der Ausnahme von China) netto so viel Kapital.
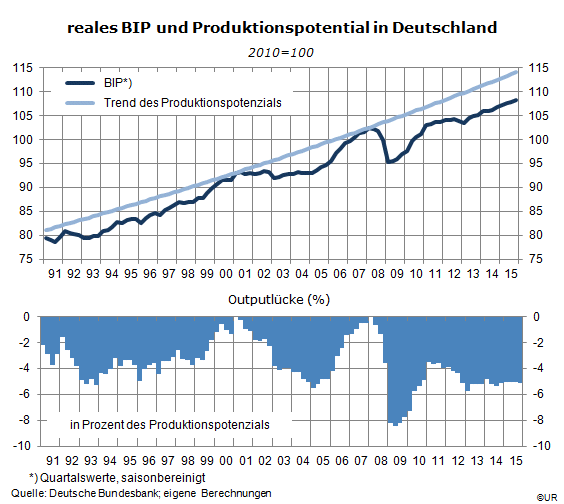
Wie dieses Schaubild zeigt, herrscht hierzulande keineswegs Vollbeschäftigung – am Arbeitsmarkt läuft es, aber die Outputlücke liegt immer noch bei etwas über fünf Prozent. Inflationsgefahren gibt es nicht – leider, muss man aus heutiger Sicht sagen –, eher droht weiterhin Deflation. Es wäre völlig gefahrlos, die staatlichen Ausgaben um beispielsweise zwei Prozent zu steigern, also etwa um 60 Milliarden Euro, oder die Steuern entsprechend zu senken. Letzteres ist allerdings weniger wirksam, da nicht ausgemacht ist, dass das zusätzliche verfügbare Einkommen nicht für den Abbau von Schulden verwendet wird. Um aus der Liquiditätsfalle herauszukommen, muss die Endnachfrage kräftig gesteigert werden, das ist das A und O. Die Geldpolitik braucht dringend eine finanzpolitische Flankierung.
Ähnlich großen Spielraum wie Deutschland haben die Schweiz, Österreich, Holland und die skandinavischen Länder. Selbst Frankreich, Italien und Spanien könnten angesichts ihrer niedrigen Inflationsraten und Kapitalmarktzinsen für eine Weile einen Dispens von kontraproduktiven Auflagen des Stabilitäts- und Wachstumspakts bekommen. Zusätzliche staatliche Schulden sind weniger gefährlich als eine dauerhaft hohe Arbeitslosigkeit und eine stagnierende Wirtschaft. Irgendjemand muss Schulden machen – wenn es die Privaten nicht wollen, bleibt nur der Staat.