Am Mittwoch gab es die detaillierten Zahlen zum BIP im zweiten Quartal. Die Struktur des Wachstums war deutlich anders als im ersten Quartal: dynamischer Außenhandel, kleine positive Beiträge vom privaten und staatlichen Konsum, aber Bremseffekte durch die Ausrüstungsinvestitionen und den Bau. Nichts Dramatisches.
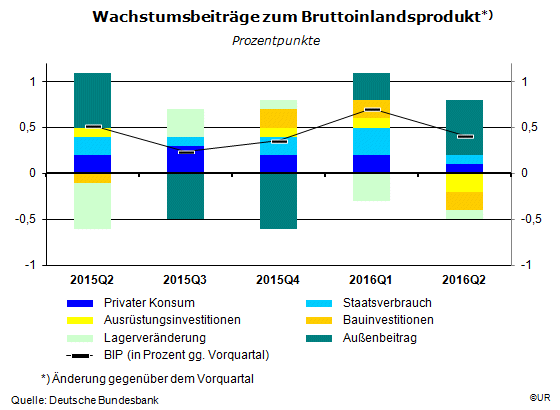
Da die Stimmung bei den Haushalten und den Unternehmen gut ist, die staatlichen Finanzen gesund und die Zinsen rekordniedrig sind, ist damit zu rechnen, dass die inländische Nachfrage weiter zunehmen wird. Dass der Außenbeitrag noch einmal so groß ausfällt wie zuletzt, ist nicht wahrscheinlich, weil der Welthandel vor sich hin dümpelt – die Globalisierung legt zurzeit eine Pause ein – und weil der Euro eher auf- als abwertet.
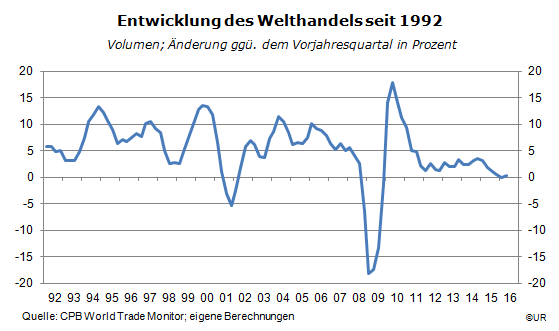
Es herrscht ein breiter Konsens (dem ich mich anschließe), dass das reale BIP in diesem Jahr knapp zwei Prozent höher sein wird als 2015, und dass es 2017 wegen des sogenannten Kalendereffekts etwas weniger sein wird. So sieht derzeit ein deutscher Aufschwung aus. Echte Inflationsgefahren sind in einem solchen Umfeld nicht auszumachen.
Die neue Wachstumsformel lautet: +0,8 Prozent Produktivität mal Zunahme der Arbeitsstunden um etwa ein Prozent ergibt einen jährlicher Anstieg des realen BIP von rund 1,8 Prozent. Es ist erfreulich, dass die Beschäftigung in den vergangenen Jahren so kräftig zugenommen hat, aber das wird sich nur aufrechterhalten lassen, wenn die Regierung nicht versucht, die Zuwanderung zu unterbinden oder stark zu beschränken. Auf Dauer hängt das Wachstum sonst allein von der Produktivität ab. Und da sieht es nicht gut aus.
Bekanntlich bestimmen vor allem die Investitionen in Ausrüstungen, Infrastruktur und berufliche Qualifikation, wie viel mehr pro Stunde erzeugt werden kann und wie sich daher unser Lebensstandard entwickelt. Die Infrastruktur gilt vielfach als ein bisschen verrottet, und auch bei der Bildung besteht immer ein Verbesserungsbedarf, entscheidend ist auf die kürzere Sicht, was sich bei den Ausrüstungen tut, also beim Wachstum des direkt in der Produktion eingesetzten Sachkapitals. Sie hängen von den Umsatz- und damit den Gewinnerwartungen der Unternehmen ab, zudem von der Attraktivität des Standorts „Deutschland“ im Vergleich zu ausländischen Alternativen.
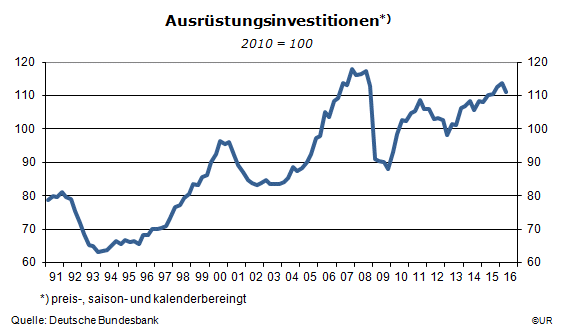
Trotz der ausgezeichneten internationalen Wettbewerbsfähigkeit, der niedrigen Realzinsen auf Fremd- und Eigenkapital und des erstaunlich spannungsarmen Verhältnisses zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern kommen die Investitionen einfach nicht in Schwung. Nach der kurzen Erholung in den Jahren 2010 und 2011, als Reaktion auf die tiefe Rezession, treten sie fast auf der Stelle. Seit dem zweiten Quartal 2011 sind die realen Ausrüstungen im Jahresdurchschnitt nur um 1,0 Prozent gestiegen und liegen immer noch um sechs Prozent unter dem Vor-Krisenwert von 2007. Zum Vergleich: Zwischen 1991 und 2007 hatten sie im Jahresdurchschnitt um 2,5 Prozent zugelegt. Die Dynamik ist raus.
Wer daraus schließt, daran sei der Euro schuld, liegt falsch. Deutschland ist unter den Industrieländern kein Einzelfall: Überall schwächeln die Investitionen – und mit ihnen das Produktivitätswachstum. Wie die folgende Tabelle zeigt, leiden auch die beiden anderen großen entwickelten Volkswirtschaften – die USA und Japan – unter diesem Phänomen; es ging ihnen zuletzt nur marginal etwas besser als der deutschen Wirtschaft. Vom allgemeinen Trend haben sie sich nicht abkoppeln können.
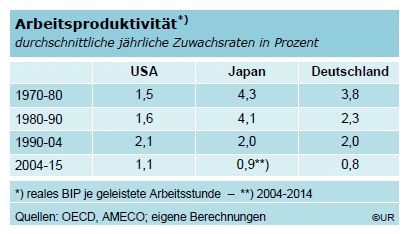
Von den Wundern der Digitalisierung ist bisher nichts zu sehen. Vielleicht ist es noch zu früh für ein abschließendes Urteil, aber wenn sie so große Effizienzgewinne mit sich bringt wie immer behauptet, müssten in den Zahlen doch zumindest erste Anzeichen zu erkennen sein. Sind sie nicht. Robert Gordon, der Produktivitätspapst von der Northwestern University in Illinois, hat kürzlich darauf hingewiesen, dass eine Reise vom Zentrum in Chicago nach Manhattan trotz der schnelleren Flugzeuge heute genauso lange dauert wie 1930 (wenn ich mich recht erinnere) – weil man an beiden Enden ständig im Stau steht. Produktivitätsgewinne werden vielfach durch Produktivitätsverluste (sogenannte externe Effekte) aufgefressen.
Innerhalb Eurolands dasselbe Bild: Nach den Wirtschaftwunderjahren der Nachkriegszeit, die bis Ende der Achtziger dauerten, gingen die Zuwachsraten abrupt zurück. Sie betragen nur noch ein Viertel dessen, was in den siebziger Jahren Standard war. Am härtesten hat es Italien getroffen: Das Festkurssystem des Euro hat die strukturellen Schwächen erbarmungslos offengelegt. Es gibt kein Ventil namens „Abwertung“ mehr, und es fehlt offenbar an Konzepten, wie man unter diesen Bedingungen überleben kann. Immer mehr Analysten, vor allem angelsächsische, gehen daher davon aus, dass Italien den Euro über kurz oder lang aufgeben muss.
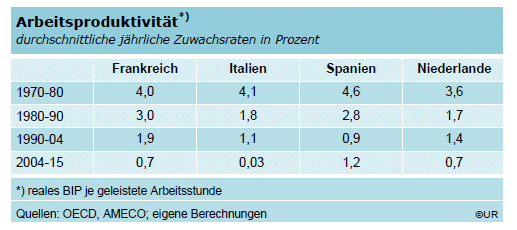
Dass die Produktivitätsschwäche wenig bis nichts mit der europäischen Einheitswährung zu tun hat, zeigt auch ein Vergleich mit den Entwicklungen in Großbritannien, Schweden, der Schweiz und Kanada, also Ländern mit eigener Währung. Die Botschaft lautet: Auch wenn ich mein Pfund, meine Krone, meinen Franken und meinen Dollar behalte und bei Bedarf abwerten kann, komme ich nicht gegen die globalen Megatrends an, also den unaufhaltsamen Rückgang der Zuwachsraten bei der Produktivität. Am drastischsten war der Einbruch bislang außer in Italien auf der britischen Insel, wo man sich viel darauf zugutehält, dass man mit den Wirren des Kontinents nichts zu tun hat. Hat nichts geholfen. Vielleicht war es keine so gute Idee, sein Wohl und Wehe so sehr vom Immobilienmarkt, dem Londoner Finanzzentrum und dem Nordseeöl abhängig zu machen.
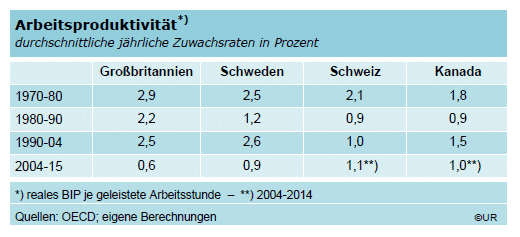
Insgesamt ist es verständlich, dass sich immer mehr Ökonomen fragen, woher denn nun diese secular stagnation komme. Es ist, ein bisschen verspätet, die Modefrage der Saison. Zwei Denkschulen stehen sich gegenüber. Die Angebotstheoretiker weisen darauf hin, dass die Grenzproduktivität des Kapitalstocks nachlässt, je größer er ist. Ein zweiter Suezkanal verbessert die internationale Arbeitsteilung nicht im selben Maße wie der erste, oder wenn ich schon zwei Autos habe, bringt mir ein drittes nicht viel an Zusatzgewinn. Es ist eine plausible Argumentation. Begleitet wird das Ganze von der sogenannten Saving Glut, einem globalen Überangebot an Ersparnissen, verbunden mit sogenannten Fehlallokationen – zu viel Geld fließt in wenig produktive Immobilienprojekte.
Für die Nachfragetheoretiker liegt das Übel in einer übertriebenen Restriktionspolitik der Staaten: Sie haben auf die gewaltig gestiegenen Haushaltsdefizite und Schulden im Gefolge der Rettungsaktionen für die Banken mit pro-zyklischen Maßnahmen reagiert und dadurch die Sache noch schlimmer gemacht. Die Analysten dieses Lagers plädieren dafür, Defizite hinzunehmen oder sogar bewusst zu vergrößern, bis die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten wieder annähernd voll ausgelastet sind. Das wäre besonders dann wichtig, wenn wichtige Teile des privaten Sektors damit beschäftigt sind, von ihren Schuldenbergen herunterzukommen, also übermäßig viel zu sparen (im Berliner Finanzministerium und in der Bundesbank dürfte eine solche Argumentation Begeisterungsstürme auslösen).
Vielleicht haben wir es tatsächlich mit einer Art ehernen Gesetzes zu tun, dessen Ergebnisse im Wesentlichen hinzunehmen wären. In alternden Gesellschaften wäre das aber die falsche Reaktion. Es ist ja nicht so, dass der Wirtschaftspolitik die Instrumente ausgegangen wären, mit denen die Produktivität auf einen steileren Wachstumspfad gehievt werden kann. Da es sich um langfristige Entwicklungen handelt, ist das Problembewusstsein leider nicht sehr ausgeprägt. Wahlen lassen sich nach allgemeinem Verständnis nicht mit einer Wachstumspolitik gewinnen. Ich glaube, dass das ein Irrtum ist.