Aus deutscher Sicht läuft es wirtschaftlich ziemlich gut, wenn wir mal von den vielen Millionen prekärer Jobs oder der ungleichen Verteilung von Vermögen und Einkommen absehen. Es gab 2016 so viele Jobs wie noch nie, 43,5 Millionen und damit ein Prozent mehr als im Vorjahr, es herrscht nicht nur nahezu Vollbeschäftigung, sondern auch Preisstabilität, der Staat erwirtschaftet seit Jahren Budgetüberschüsse, kaum ein anderes Land ist international so wettbewerbsfähig, und die Zuwachsrate des realen BIP von 1,9 Prozent, wie sie im abgelaufenen Jahr erreicht worden ist, kann sich sehen lassen.
Aber in einer Hinsicht läuft es gar nicht gut: Die Produktivität wächst seit fast zehn Jahren nur noch sehr langsamen. Der Sachverständigenrat für Wirtschaft schreibt in seinem letzten Jahresgutachten (S. 126f.), dass „die Potenzialwachstumsrate der Arbeitsproduktivität seit Beginn der 1990er-Jahre von über 2% auf 0,8% im Jahr 2009 gefallen [ist] und […] seitdem auf diesem Niveau [verharrt].“ Bei zwei Prozent im Jahr verdoppelt sich der Output pro Arbeitsstunde alle 35 Jahre, wenn es bei einer Zuwachsrate von 0,8 Prozent bleibt, dauert es 87 Jahre, also ein ganzes Menschenleben lang. Das war in der Vergangenheit viel besser. Sollte der Input an Stunden also um 0,8 Prozent jährlich zurückgehen, kann das reale BIP nicht mehr steigen. Manche halten das angesichts des demografischen Wandels für gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn dann gleichzeitig Einkommen und Vermögen weiterhin immer ungleichmäßiger verteilt werden, ergibt sich eine politisch explosive Mixtur.
Wie die folgende Tabelle zeigt, hat die Arbeitsproduktivität im Verlauf der Zeit mit ständig niedrigeren Raten zugenommen; in den letzten zehn Jahren ist die Zuwachsrate bei 0,8 Prozent angekommen.
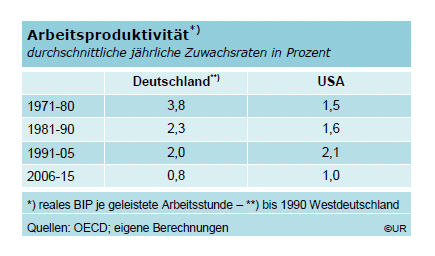
Es wird mehr gearbeitet, gemessen an der Anzahl neuer Jobs und dem gesamtwirtschaftlichen Anstieg der Arbeitsstunden, aber pro Stunde nimmt der Output fast nicht mehr zu. Es fehlt an Effizienzgewinnen bei der Produktion der Güter und Dienstleistungen. Der größte Teil des BIP-Wachstum stammte zuletzt aus der Zunahme der Beschäftigung, nicht aus dem effizienteren Einsatz der Mittel.
Die Tabelle zeigt auch, dass es in den USA nicht viel anders war – dort hat sich die Zuwachsrate der Produktivität gegenüber der vorangegangenen Periode in etwa halbiert. Nun könnte man argumentieren, dass es so etwas immer mal wieder gegeben hatte, weil wir es bei Innovationsschüben und Investitionszyklen nicht mit stetig verlaufenden Prozessen zu tun haben, man sich also keine Sorgen zu machen braucht. Ob es sich um ein zyklisches oder ein strukturelles Phänomen handelt, lässt sich allerdings erst im Nachhinein sagen; jedenfalls wird zur Zeit wieder einmal lebhaft über die „säkulare Stagnation“ diskutiert, was bedeutet, dass viele Ökonomen den Rückgang des Produktivitätswachstums eben nicht für etwas Vorübergehendes halten. Wie kommen sie darauf und welche Therapie schlagen sie vor?
Vor Kurzem hat sich Bradford DeLong, Professor in Berkeley, in seinem Blog dazu geäußert (Three, Four… Many Secular Stagnations). Ausgangspunkt ist für ihn die Beobachtung, dass die Realzinsen sowohl am kurzen als auch am langen Ende seit Jahrzehnten rückläufig sind. Die folgende Grafik zeigt die „realen“ Renditen der zehnjährigen amerikanischen und deutschen Staatsanleihen. Bei Unternehmensanleihen ist der Trend nicht anders, nur das Niveau ist höher, soll heißen, dass Sachinvestitionen im Zeitverlauf unattraktiver geworden sind oder dass das Angebot an Ersparnissen viel stärker zugenommen hat als die Nachfrage.
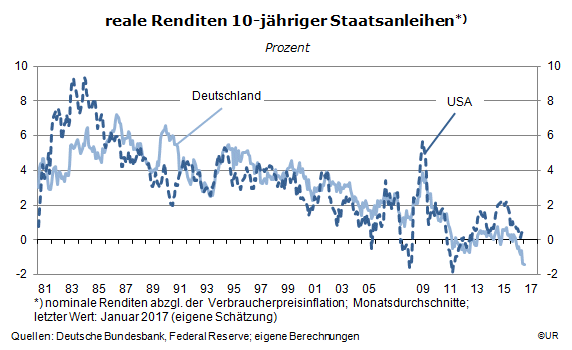
DeLong präsentiert eine Liste mit sieben verschiedenen Erklärungsversuchen:
- Durch die ungleiche Einkommensverteilung wird zu viel gespart – die Reichen konsumieren nicht genug (These von Hobson).
- Da technischer Fortschritt und Bevölkerungswachstum stagnieren, sinkt die Ertragsrate der Investitionen, so dass zu wenig investiert wird (Hansen).
- Bedeutende Anleger, bei denen nicht das Gewinnmotiv sondern die politischen Risiken im Vordergrund stehen, haben eine starke Nachfrage nach sicheren Assets ausgelöst und deren reale Renditen gesenkt (Bernanke und seine saving glut).
- Der Finanzsektor ist dysfunktional: Es gelingt ihm nicht, die Risikobereitschaft der Gesellschaft zu mobilisieren. Dadurch ist eine gewaltige Lücke zwischen der Verzinsung riskanter und sicherer Anlagen entstanden (Rogoff).
- Wegen der sehr niedrigen aktuellen und erwarteten Inflation ist selbst ein „sicherer“ nominaler Zins von Null zu hoch für eine Balance zwischen Investitionsvorhaben und Sparplänen bei Vollbeschäftigung. Wir hätten es mit einer Rückkehr der depression economics zu tun (Krugman, Blanchard).
- Die schwache Nachfrage nach Kapitalgütern zusammen mit deren raschem Preisverfall haben die Gewinnaussichten von Firmen dieses Sektors stark verschlechtert.
- Das ist ein Punkt, den ich nicht richtig verstehe und den ich deswegen hier mal weglasse.
Harvards Larry Summers, der die jetzige Diskussion angestoßen hat, hat sich zu all diesen Aspekten geäußert, ohne aber ein konsistentes Gesamtmodell entwickelt zu haben.
Was die Therapie angeht, herrscht unter den Ökonomen, die sich mit dem Thema „säkulare Stagnation“ befassen, Einigkeit, dass es der private Sektor allein nicht schaffen kann und der Staat daher aktiv werden muss. Summers sieht hier zwei Ansatzpunkte: Zum Einen sollte die Verteilung von Vermögen und Einkommen durch ein progressives Steuersystem und gezielte Transfers nachhaltig korrigiert werden. Zum Anderen braucht es eine expansivere Finanzpolitik mit einem Focus auf Investitionen in Human- und Sachkapital, verbunden mit Anreizen für private Investitionen.
Das trifft sich gut mit dem Paradigmenwechsel, der in der Ökonomie begonnen hat, dass es den Märkten (einschließlich der Weltmärkte) und der Geldpolitik allein nicht gelingt, Wachstum und Wohlstand zu schaffen. Ohne den Staat geht es nicht.