Vergessen wir die Risiken. Ich tendiere gern mal dazu, sie überzubewerten, was mit meinem fortgeschrittenen Alter zu tun haben dürfte, und mehr Krisen vorherzusagen, als dann tatsächlich eintreten. Ich schwenke im Folgenden also auf die Linie meines Mitstreiters Robert von Heusinger ein und zeichne ein optimistisches Bild der Weltkonjunktur. Über das, was alles schief gehen könnte, werde ich mich hier später mal ausführlicher auslassen.
Ausgangspunkt ist die Tabelle, in der ich die jeweils neuesten Daten zu Wachstum und Inflation versammelt habe, um ein möglichst aktuelles Bild zu vermitteln. Eigentlich darf man nicht Verlaufsraten und Zuwachsraten im Vorjahresvergleich, oder Zahlen vom zweiten und dritten Quartal zusammenrühren, wie ich es dort getan habe. Der Vorteil ist aber, dass ich dichter an der tatsächlichen Lage dran bin als es sonst möglich wäre.
|
Aktuelle Wachstumsraten ausgewählter Länder und Regionen |
||||
|
BIP |
reales |
Industrie- |
Verbraucher- |
|
|
Euroraum |
14,8 |
3,6 |
5,2 |
1,7 |
|
GB |
3,0 |
2,8 |
0,7 |
2,4 |
|
USA |
20,1 |
1,6 |
5,6 |
2,1 |
|
Japan |
6,4 |
1,0 |
5,9 |
0,6 |
|
China |
15,4 |
10,4 |
16,1 |
1,5 |
|
Indien |
6,0 |
8,9 |
9,7 |
6,3 |
|
asiatische |
5,7 |
7,0 |
8,0 |
2,5 |
|
Russland |
2,6 |
7,4 |
4,1 |
9,6 |
|
Mittel- |
3,3 |
5,3 |
9,0 |
2,3 |
|
übrige |
22,7 |
6,0 |
5,5 |
4,5 |
|
Welt |
100,0 |
5,3 |
7,5 |
2,9 |
|
Quellen: Internationaler Währungsfonds, Bloomberg 1) BIP zu Kaufkraftparitäten-Wechselkursen in % des Welt BIP 2) annualisierte Veränderung in % ggü. Vorquartal; asiat. Entwicklungsländer und übrige Welt: Veränderung in % ggü. Vorjahr; teilweise eigene Schätzungen 3) Veränderung in % ggü. Vorjahr; teilweise eigene Schätzungen 4) ohne China und Indien 5) ohne Russland |
||||
Die Zahlen könnten nicht besser sein! Obwohl das Wachstum in den USA und in Japan zuletzt vergleichsweise sehr niedrig ausgefallen ist, macht sich das im Weltmaßstab nicht sonderlich negativ bemerkbar, weil die übrigen Wirtschaftsregionen weiter kräftig expandieren, neuerdings sogar einschließlich des Euroraums. Dass das reale Sozialprodukt der Welt zur Zeit mit einer Rate von geschätzten 5,3 Prozent wächst, übertrifft sogar die optimistische Septemberprognose des Internationalen Währungsfonds, der für dieses Jahr mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate von 5,1 Prozent gerechnet hatte.
Zwar ließe sich argumentieren, dass sich die konjunkturelle Abkühlung der größten und der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt mit der üblichen Verzögerung auch in den anderen Ländern negativ bemerkbar machen wird. Es spricht jedoch einiges dafür, dass sich das in Grenzen halten wird. Der Hauptgrund ist, dass das Gewicht der anderen Länder in den letzten Jahren rapide zugenommen hat, vor allem das der asiatischen Entwicklungsländer, aber auch der lateinamerikanischen sowie der ehemals kommunistischen Volkswirtschaften. Diese Regionen weisen nach wie vor ein ungebrochen dynamisches Wachstum auf. Sie sind zudem auch nicht mehr, so wie einst, vor allem von Exporten abhängig. In China etwa übertrafen die realen Umsätze im Einzelhandel ihr Vorjahresniveau zuletzt um nicht weniger als 12 Prozent, die Investitionen das ihre sogar um knapp 30 Prozent. Die Inlandsnachfrage hat sich somit zum Motor des Aufschwungs entwickelt.
Hinzu kommt, dass sich die finanzielle Lage in den Schwellenländern stark verbessert hat. Jahrelange Überschüsse in den Leistungsbilanzen oder Nettokapitalzuflüsse, oder beides, haben dazu geführt, dass ihre Währungen vor allem gegenüber dem Dollar unter Aufwertungsdruck stehen. Um den Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit, der durch eine Aufwertung verursacht worden wäre, zu vermeiden, kauften sie in großem Stil Dollar auf und erhöhten auf diese Weise ihre Währungsreserven. Die amerikanischen Nettokapitalimporte von mehr als 800 Mrd. Dollar fanden ihr Spiegelbild vor allem in einem Anstieg der Dollarforderungen der Schwellenländer. Deren Bonität hat sich entsprechend verbessert. Sie können daher nicht nur ein hohes Importniveau aufrechterhalten, es fällt ihnen auch viel leichter als früher, sich an den internationalen Kapitalmärkten zu günstigen Konditionen zu verschulden, soweit sie das überhaupt noch nötig haben.
Das wiederum versetzt sie erstmals in die Lage, die Inlandsnachfrage ankurbeln zu können, wenn beispielsweise einmal die Exporte wegbrechen sollten. Sie müssten nicht sofort negative außenwirtschaftliche Folgen befürchten. Sie haben auch deshalb viel mehr wirtschaftspolitischen Spielraum als bislang gewohnt, weil ihr Aufschwung einhergeht mit einer kräftigen Expansion ihres Kapitalstocks und damit der Produktivität. Zudem gibt es meist ein Reservoir an unterbeschäftigten Arbeitskräften, so dass die Lohnstückkosten, obwohl die Lohnsumme rasch steigt, unter Kontrolle bleiben. Hinsichtlich der Inflation gibt es von daher so gut wie keine Probleme in den Schwellenländern.
Was die Lage in Japan angeht, spricht einiges dafür, dass wir es zuletzt nur mit einer Wachstumspause und nicht mit etwas Ernsterem zu tun hatten. Die nominalen ebenso wie die realen Auftragseingänge, etwa im Maschinenbau, lagen im Dreimonatszeitraum Juni bis August um etwa 12 Prozent höher als vor Jahresfrist. Das spricht für eine gesunde Investitionskonjunktur. Die Exporte laufen zudem nach wie vor sehr gut, was angesichts des schwachen Yen, der Hochkonjunktur im übrigen Ostasien und der vermutlich immer noch niedrigen Kapazitätsauslastung nicht weiter verwundert.
Ein Problem ist jedoch der Ausgabenrückgang im öffentlichen Sektor. Die japanische Regierung reagiert damit auf die rekordhohen Schulden, dämpft aber auf kurze Sicht auch die Gesamtnachfrage. Wichtiger noch ist die Zurückhaltung der Verbraucher, deren Einkommen angesichts realer Lohnsteigerungen von 0,3 Prozent und eines Beschäftigungsanstiegs von 0,4 Prozent nur sehr langsam zunehmen. Außerdem ist die Deflation noch keineswegs überwunden, wenn man bedenkt, dass der Deflator des Sozialprodukts um 0,8 Prozent fiel und die Verbraucherpreise (ohne Energie und Nahrungsmitteln) ebenfalls deutlich sinken. Wenn die Preise fallen, stellen die Leute größere Anschaffungen zurück – es geschieht das Gegenteil dessen, was man in Deutschland im Zusammenhang mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer erwartet: Der Anstieg der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent löst Vorzieheffekte aus und sollte in diesen Monaten die Konsumkonjunktur stimulieren (davon ist allerdings bisher nicht viel zu sehen).
Japan wartet also immer noch auf einen sich selbst tragenden Aufschwung. Da die Wirtschaft aber super-wettbewerbsfähig ist und die Konjunktur in den Hauptabnehmerländern – außer in den USA – brummt, ist damit zu rechnen, dass wir bald wieder Zuwachsraten von 2 ½ Prozent statt von 1 Prozent sehen werden, und der Beitrag zum Wachstum der Weltwirtschaft positiver ausfallen wird.
Erfreulich ist vor allem aber, dass sich Europa zu einer Wachstumslokomotive entwickelt. Dadurch, dass die Unternehmensinvestitionen angesprungen sind und die deutsche Bauwirtschaft endlich wieder in Schwung gekommen ist, stützt sich die Konjunktur erstmals seit Jahren wieder auf ein breiteres Fundament, nicht nur auf den Export.
Mit den Ausgaben der Verbraucher hapert es allerdings noch immer. Der deutsche Einzelhandelsumsatz ist im September beispielsweise real und saisonbereinigt gegenüber dem August um 1,7 Prozent und gegenüber dem September des Vorjahres um 0,6 Prozent eingebrochen, was weder zu erwarten war, noch angesichts der kommenden Steuererhöhung plausibel ist.
Trotzdem bin ich ganz optimistisch, was den privaten Konsum in der Währungsunion insgesamt angeht, seitdem die Beschäftigung mit einer Rate von knapp 1 ½ Prozent zuzunehmen begonnen hat und auch die Reallöhne durch den Rückgang der Inflationsrate auf 1,6 Prozent im Oktober endlich wieder rascher steigen – um knapp 1 Prozent im Vorjahresvergleich. Die meisten Analysten vermuten allerdings, dass es im ersten Halbjahr 2007 durch die Steuereffekte bei der bei weitem wichtigsten Komponente der Nachfrage, dem Konsum, erst einmal einen Schock geben wird. Die höheren Zinsen sind auch nicht gerade hilfreich.
Nach so vielen Jahren der Kaufzurückhaltung hat sich aber wahrscheinlich ein Nachfragestau entwickelt. Bei den Umfragen zum Verbrauchervertrauen gibt es seit Mitte 2005 einen steigenden Trend, und die Haushalte haben angesichts einer durchschnittlichen Bruttosparquote von 14,7 Prozent die finanziellen Reserven für mehr Ausgaben. Sie könnten, wenn sie wollten.
Die Wirtschaft von Euroland hat inzwischen eine beträchtliche Eigendynamik entwickelt, so dass es möglicherweise gar nicht zu einem nennenswerten Rückgang der Wachstumsraten kommt. Sie liegen in diesem Jahr bisher bei etwas über 3 ½ Prozent. Die Exporte laufen gut, der Wohnungsmarkt expandiert nach wie vor kräftig, wenn man sich die Hypothekenkredite anschaut, die Auftragseingänge nehmen zweistellig zu, alle Umfragen zeigen nach oben, der Wechselkurs macht offenbar keine Probleme, die Finanzpolitik kann angesichts rückläufiger Defizite den Fuß etwas von der Bremse nehmen, die EZB wird in Kürze ihr Zinsziel erreicht haben, und die Gewinne der Unternehmen steigen aufs Erfreulichste. Das ist alles so positiv, dass sich eigentlich auch die Verbraucher aus ihrer Ecke hervortrauen sollten. Ob sie das tun, ist die Gretchenfrage der europäischen Konjunktur.
Jedenfalls sieht es insgesamt so aus, als ob Euroland nicht mehr sonderlich abhängig ist von der US-Konjunktur. Die Exporte ins boomende Asien ex-Japan sind inzwischen um 30 Prozent höher als die nach Amerika. Zudem ist Euroland, wenn man Großbritannien, Dänemark, Schweden und die Schweiz hinzurechnet, weil sie de facto feste Wechselkurse zum Euro haben, so groß wie die USA und eine ähnlich geschlossene Wirtschaft. Sie ist viel resistenter gegenüber Schocks aus dem Ausland als es die einzelnen Länder früher je für sich waren.
Es gibt im Euroland auch keine bedeutenden Ungleichgewichte, die beseitigt werden müssten, weder am Wohnungsmarkt, noch am Aktienmarkt, noch in der Leistungsbilanz. Das einzige Ungleichgewicht, das Sorge macht, ist das Auseinanderlaufen der Einkommen von Kapital und Arbeit. Das ist die eigentliche Ursache für die anhaltende Konsumschwäche. Aber selbst hier kann man etwas optimistischer sein: Zum einen haben die Verbraucher durch den Verfall der Ölpreise wieder deutlich mehr Geld in der Tasche, nachdem zuvor die gesamte Verteuerung zu ihren Lasten gegangen war, zum anderen ist Kapital zunehmend reichlich, was seine Ertragschancen tendenziell mindert und die Nachfrage nach Arbeit steigert. Ein Effekt wird ein wieder stärkerer Anstieg der Löhne in Richtung Produktivitätswachstum plus Inflation sein. Bisher waren sie deutlich unter dieser verteilungsneutralen Marke geblieben.
Obwohl ich ganz zuversichtlich bin, dass die Weltwirtschaft auch ohne die USA kräftig wachsen kann, wäre es natürlich besser, wenn es auch in Amerika zu keinem Einbruch kommt. Die Risiken sind allerdings beträchtlich. Insbesondere der Wohnungsmarkt, der bislang die wichtigste Stütze der robusten Konsumkonjunktur war, befindet sich im freien Fall. Die Preise neuer Häuser sind gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent gefallen, mehr als in früheren Rezessionen der Nachkriegszeit. Der Absatz neuer Häuser ist um 14,2 Prozent zurückgegangen, und die berühmten „housing starts“ sogar um 17,9 Prozent. Das beliebte Partythema, die sogenannten „net equity withdrawals“, das sind die Beleihungen der im Wert ständig gestiegenen Immobilien für Konsumausgaben, hat seine Attraktivität verloren, nachdem nun die Luft aus den Preisen raus ist.
Glaubt man dem Yale-Professor Robert Shiller, sind die Immobilienpreise, bereinigt um die allgemeine Inflationsraten, noch nie in der Geschichte Amerikas so überteuert gewesen wie heute. (siehe Grafik) Das Rückschlagspotential dürfte mehr als 35 Prozent betragen. Da der Wert des Immobilienbestands etwa das Dreifache des jährlich verfügbaren Einkommens ausmacht, wäre ein solcher Preiseinbruch ein gewaltiger Schock, der geradewegs eine ausgewachsene Rezession auslösen dürfte. Da das einhergehen würde mit einem Dollarcrash, wären die Folgen für uns und den Rest der Welt letztlich doch sehr ernst.
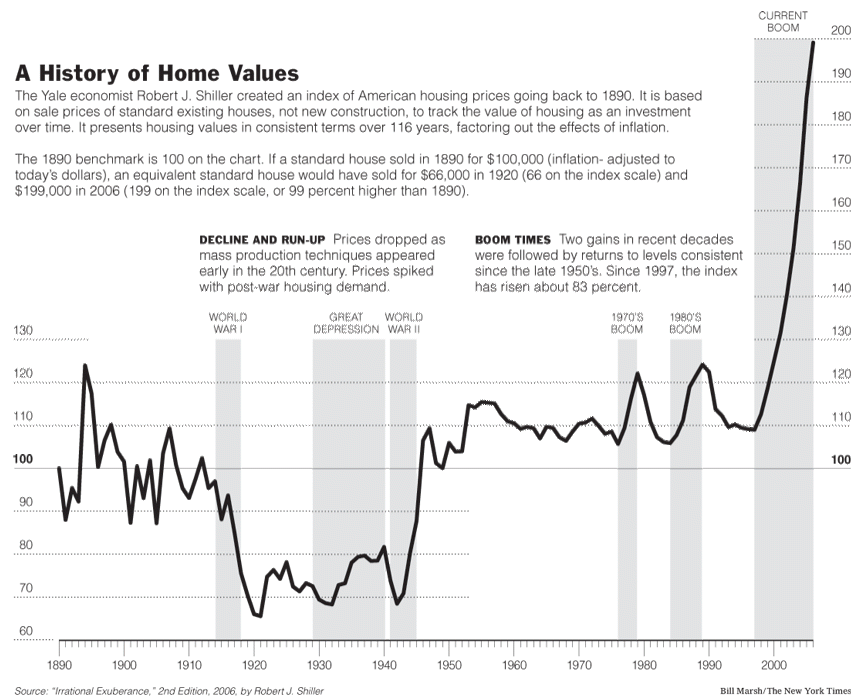
(zum Vergößern auf die Grafik klicken)
Aber ich wollte ja nicht über Risiken sprechen. Die meisten Ökonomen, einschließlich Alan Greenspan, sind der Meinung, dass eine solche Gefahr nicht sonderlich realistisch ist. Die Liste der Argumente, dass es in den USA schon bald wieder zu einer Beschleunigung des Wachstums kommen könnte, ist lang:
- die niedrigeren Ölpreise erhöhen gerade wieder die real verfügbaren Einkommen der Verbraucher
- die Fed ist in der Nähe ihres Zinsziels angekommen und wird bald über die erste Senkung nachdenken
- die Gewinne der Unternehmen steigen immer noch zügig
- die Aktienmärkte sind relativ fest
- es herrscht de facto Vollbeschäftigung
- die realen Einkommen der privaten Haushalte liegen um 4,6 Prozent über ihren Vorjahreswerten
- die Fed kann im Bedarfsfall die Zinsen um 525 Basispunkte senken, kann also bei Rezessionsgefahr gut gegenhalten
- der Dollar würde abwerten und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der USA verbessern
Was also sind die Schlussfolgerungen? Insgesamt befindet sich die Weltwirtschaft in guter Verfassung. Das Wachstum wird vor allem von Investitionen getrieben, also von der Angebotsseite, und Produktivität und Löhne nehmen etwa im Gleichschritt zu, so dass die Inflationsrisiken fürs erste gering sind. Es besteht daher wenig Anlass für die Wirtschaftspolitik, restriktive Maßnahmen zu ergreifen. Positiv ist auch, dass der Wachstumsprozess auf so vielen Schultern ruht und damit einigermaßen resistent gegen Schocks ist, ebenso wie die Tatsache, dass Europa jetzt mit von der Partie ist. Asien und Europa sind zusammen so groß und expandieren so kräftig, dass sie die vorübergehende (?) Wachstumsschwäche Amerikas ausgleichen dürften. Wir leben in der besten aller Welten, wie Pangloss, der Lehrer Candides sagen würde. Oder?