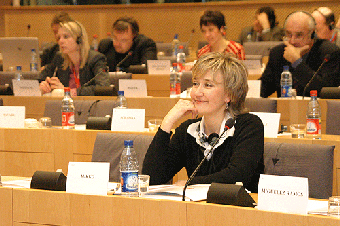Das mangelnde Gefühl der EU für Bürgerrechte sorgt für immer größere Spannungen im Staatengebälk. Droht Europa ein „Supernova-Effekt“?
Wird den Schöpfern des Lissabon-Vertrages gerade mulmig darüber, was die EU neuerdings dürfen darf? Das Bundesverfassungsgericht hat gerade die Vorratsdatenspeicherung für grundgesetzwidrig erklärt. Das deutsche Ausführungsgesetz, das die Richter wegen unzureichender Genauigkeit und zu breiter Eingriffsgrundlagen verwarfen, stützte sich auf eine EU-Richtlinie, die am 15. März 2006 erging. Sie verpflichtet alle 27 Mitgliedsstaaten der EU, praktisch alle Telekommunikationsdaten ihrer Bürger mindestens ein halbes Jahr zu speichern, zum Zwecke der „Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von schweren Straftaten“.
Mit einigen Jahren Verspätung fragen sich jetzt immer mehr EU-Staaten, was für eine Regelung sie damit eigentlich in die Welt gesetzt haben – und welche weiteren Eingriffe in die Bürgerrechte der Europäer der Lissabon-Vertrag möglich macht. Die Vorratsdatenspeicherung ist – obwohl Vergangenheit – ein Lehrbeispiel dafür, auf welchen Wegen und von welchen Interessen gelenkt in Zukunft verstärkt europäische Bürgerrechtseingriffe stattfinden können.
Die neue EU-Kommissarin für Innen- und Justizpolitik, die Schwedin Cecilia Malmström, kündigte soeben an, die Nutzen und Kosten der Vorratsdaten-Richtlinie bis September überprüfen zu lassen. Die Richtlinie war von Anfang an umstritten. Irland und die Slowakei hatten im Ministerrat gegen die Sammelanordnung votiert. Doch sie wurden überstimmt.
Und genau hier beginnt der Fall exemplarisch zu werden für die EU als problematische Rechtssetzungsinstanz. Im Staatenpool von Brüssel herrscht eine legislative Dynamik, die mit den üblichen Mitteln von Politik und Öffentlichkeit nicht zu kontrollieren ist. Daran ändert der Lissabon-Vertrag nichts – im Gegenteil.
Schon seit 2002 gab es Überlegungen für Datenspeicherungen, um Terroristen auf die Spur zu kommen. Im Jahr 2005 ging dann plötzlich alles sehr schnell – wegen zweier Ereignissen. Am 1. Juli übernahm Großbritannien die halbjährliche EU-Ratspräsidentschaft. Am 7. Juli explodierten in London vier Bomben von Selbstmordattentätern, die in der U-Bahn und in einem Bus 56 Menschen in den Tod rissen. Der britischen Innenminister Charles Clarke nahm sich darauf hin vor, die Vorratsdatenspeicherung so schnell wie möglich durch die Brüsseler Instanzen zu peitschen.
Dazu umging Clarke die EU-Rechtssetzungsregeln. Denn trotz der Schockwelle von London zeigten sich mehrere Staaten skeptisch, ob die Richtlinie verhältnismäßig sein würde. Für Rechtsakte in der Justiz- und Innenpolitik brauchte es damals aber Einstimmigkeit im Ministerrat. Die britische Regierung erklärte die Vorratsdatenspeicherung deshalb kurzerhand zu einer Maßnahme zur Harmonisierung des Binnenmarkts.
Für solche Rechtsvorschriften gilt in der Brüssel das Express-Verfahren. Im Rat braucht es keine Einstimmigkeit – dafür aber muss das Europäische Parlament der Vorlage zustimmen. Dies hatte mit dem offenkundigen Missbrauch des Verfahrens wenig Probleme. „Die Briten wussten, dass das Parlament sich nicht gegen sie stellen würde. Denn die Abgeordneten fühlten sich geschmeichelt, dass sie mitreden durften“, sagt Roderick Parkes, Brite und Leiter des Brüsseler Büros der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
Am 14. Dezember 2005 ist alles erledigt. Das Europaparlament stimmt der Vorratsdatenrichtlinie mit 378 zu 197 Stimmen zu. Es ist eine Rekordzeit für ein Brüsseler Gesetz – aber um den Preis von Präzision und Expertise. „Abgeordnete, die Einwände hatten, wurden systematisch umgangen“, sagt Roderick Parkes.
Im Ministerrat stemmten sich Irland und die Slowakei gegen den Trick, die Gesetzgebungsregelungen für den Binnenmarkt zu Zwecke der Terrorbekämpfung zu nutzen, doch ohne Erfolg. Irland klagt deswegen vorm Europäischen Gerichtshof. Dessen Richter stellen sich blind. Im Februar 2009 entscheiden sie, welche Rechtsgrundlage in Brüsseler Runden gewählt werde, müssten die Regierungen entscheiden.
Das Wichtige an dieser Historie ist: Der Lissabon-Vertrag hat genau das damals benutzte Verfahren (Mehrheit im Ministerrat plus Zustimmung des Europäischen Parlamentes) zum Standard für die Gesetzgebung in der Justiz- und Innenpolitik gemacht.
Für Länder wie Großbritannien und Spanien ist eine effiziente Terrorismusbekämpfung auch weiterhin der Maßstab aller Datenerhebungen – und die deutsche Bedenkenträgerei zunehmend ein Rätsel.
„Es gibt im Rat eine klare Mehrheit, die sagt: Spinnen die Deutschen?“, bekennt freimütig Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). „Aber wir haben nun einmal diese besondere Tradition, es hilft nichts.“
Der Unions-Minister de Mazière ist allerdings aus Sicht der Hardliner-Staaten nicht so sehr das Problem. Er demonstrierte zuletzt Europa-Treue, als er sich bei der Abstimmung über das umstrittenen Swift-Abkommen im Rat der Stimme enthielt.
Mit größerer Sorge verfolgen insbesondere die Briten das Treiben der liberalen deutsche Justizministerin. Britische Diplomaten in Brüssel sind dieser Tage nicht nur hoch interessiert daran, wie sich Sabine Leutheusser-Schnarrenberger korrekt ausspricht. Sondern auch, wie die Dame tickt. Erst klagte sie höchstpesönlich in Karlsruhe gegen die Vorratsdatenspeicherung, dann empfahl sie dem Europaparlament auch noch, gegen das Swift-Abkommen zu stimmen. Was kommt als nächstes?
1995, man erinnert sich, trat Leutheusser-Schnarrenberger unter Tränen als Justizministerin zurück, weil die FDP im Bundestag dem „Großen Lauschangriff“ zugestimmt hatte. Könnte sie sich vorstellen, ihr Schicksal mit ebensolcher Konsequenz an den Ausgang einer Abstimmung im Brüsseler Rat zu binden? Das sei, antwortet Leutheusser-Schnarrenberger der ZEIT, eine hypothetische Frage. „Jetzt geht es doch erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht einfach auf uns zurollen lassen. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, sondern müssen uns einbringen.“ Vom europäischen Parlament erwartet sie, dass es sich eine „starke Position erkämpft.“
Aber es gibt noch mehr wankelmütige Germanen, die das Brüsseler Diplomatenkorps derzeit mit Argus-Augen verfolgt. Allen voran die Richter in Karlsruhe. Noch, so machten sie in ihrer Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung klar, wollten sich sie an den Grundsatz des Solange-II-Urteils halten. Solange, urteilte das Bundesverfassungsgericht darin im Jahr 1986, und nur solange erkennbar sei, dass die europäische Rechtssetzung im Großen und Ganzen deutschen Grundrechtsstandards entspreche, solange werde das Karlsruher Gericht die Rechtmäßigkeit von EU-Vorschriften generell nicht überprüfen.
Ob genau dieser Standard aber noch erfüllt ist, daran haben nach dem Lissabon-Vertrag offenbar immer mehr der Richter Zweifel. In ihrem Urteil zu dem Reform-Vertrag machten sie vergangenes Jahr deutlich, dass sie sich die Prüfung von „ausbrechenden EU-Rechtsakten“ vorbehalten. Die Stimmung, mit anderen Worten, dreht sich merklich in Richtung eines Solange-III-Urteils. Kleinere Staaten verweigern der Rechtspolitik EU schon heute den Gehorsam. Irland, Österreich, Belgien, Schweden und Griechenland haben die Vorratsdaten-Richtlinie bis heute nicht in nationales Recht überführt.
Der SWP-Forscher Roderick Parkes vergleicht die zunehmenden Spannungen zwischen nationaler und internationaler Ebene in Europa mit einem drohenden „Supernova-Effekt“: „Jetzt, unmittelbar nach Inkrafttreten von Lissabon, strahlt der Stern sehr hell. Aber es kann zur Explosion kommen. Die europäische Justiz- und Innenpolitik steht an einem Wendepunkt.“