Bisher ist wenig darüber diskutiert worden, welche Rolle die Notenbanken in der gegenwärtigen Finanzkrise gespielt haben. Ihr Ziel, die Preise stabil zu halten, haben sie erreicht, sogar mehr als das, und als die Rezession einsetzte, haben sie die Zinsen gesenkt, vielleicht etwas spät, aber insgesamt für ihre Verhältnisse sehr mutig, bis in die Nähe von Null, und sie haben die Märkte mit Liquidität überschwemmt. Wie ihr Mandat es verlangt, nutzen sie damit die Spielräume, die durch den Rückgang der Verbraucherpreise entstanden sind. Die geldpolitischen Rahmenbedingungen könnten für Verbraucher und Investoren günstiger nicht sein. Dass die Konjunktur jetzt wieder in Fahrt kommt, dürfen sie sich auch auf ihre Fahnen schreiben. So weit, so gut. Daher werden sie auch kaum kritisiert. Gerade gestern hat der amerikanische Präsident angekündigt, dass er dem Senat vorschlagen werde, die Amtszeit des Fed-Chefs Bernanke, der von seinem republikanischen Vorgänger ernannt worden war, um vier Jahre zu verlängern. Barack Obama hat offenbar keine Zweifel an dessen Fähigkeiten.
Es mag ja stimmen, dass die Notenbanken für die Konjunktur tun was sie können und vielleicht auch Erfolg damit haben, aber waren sie nicht auch mitverantwortlich für die tiefe Rezession, in der wir zur Zeit stecken? Was die USA angeht, waren Alan Greenspan und Ben Bernanke, die Chefs der Fed, sogar die Hauptverantwortlichen, zusammen mit ihren Vordenkern an den amerikanischen Universitäten. Das sagt jedenfalls Andrew Smithers in seinem gerade erschienen Buch „Wall Street Revalued – Imperfect Markets and Inept Central Bankers“ (Wiley, 2009). Smithers leitete früher das Asset Management-Geschäft von S G Warburg und hatte sich 1989 selbständig gemacht. Seine Firma berät professionelle Anleger. Auf der Home Page seiner Firma wird er ohne falsche Bescheidenheit als einer der global wichtigsten („foremost“) Ökonomen vorgestellt. Trotzdem ist das Buch lesenswert. Alle Thesen sind empirisch gut belegt. (Übrigens hat gerade Stephen Roach von Morgan Stanley in der Financial Times mit „The case against Bernanke“ in dieselbe Kerbe gehauen.)
Die Zentralbanker hätten die Dinge zu lange treiben lassen, sagt Smithers, weil sie zum Einen der Ansicht waren, dass die Efficient Market Theory (EMT) auch praktisch relevant sei, dass also die Preise von Häusern oder Aktien jederzeit ihrem wahren, fundamental gerechtfertigten Wert entsprechen, so dass es eigentlich gar keine Blasen geben könne, und zum Anderen, weil sie glaubten, über die Instrumente zu verfügen, mit denen sich Finanzkrisen beherrschen lassen. Das Erste hat sich als falsch herausgestellt, und ob es der jetzigen Geldpolitik tatsächlich gelingt, die Wirtschaft auf ihren früheren Wachstumspfad zurückzuführen, ist keineswegs sicher. Aus Angst vor einer Rezession, also steigender Arbeitslosigkeit, hätte die Fed zugelassen, dass sich in den USA – und wegen deren großem Gewicht auch im Rest der Welt – gewaltige Blasen auf den Märkten für Aktien, Immobilien und nicht-staatlichen Anleihen („credit“) bildeten, deren Platzen zu großen Vermögensverlusten und einer Überschuldung von Haushalten und Unternehmen führte, was wiederum die gefährlichste Wirtschaftskrise seit den dreißiger Jahren auslöste.
Smithers vergisst zu erwähnen, dass es auch auf den Rohstoffmärkten dicke Blasen gegeben hatte: Bis zum Sommer 2008 hatte die Preishausse in allen Ländern, die Nettoimporteure von Rohstoffen sind, zu einem starken Anstieg der Verbraucherpreise geführt. Das hatte beispielsweise die EZB noch im Juli 2008 veranlasst, die Zinsen anzuheben. Zusammen mit dem Verlust an Kaufkraft durch die importierte Inflation war dies zumindest in Euroland einer der Auslöser des Konjunktureinbruchs.
Das Buch enthält zwei Hauptthesen: Erstens, der Grund für unsere heutigen Probleme war die Inkompetenz der Notenbanker. Sie waren (sind?) auf einem Auge blind. Die Fed habe viel zu lange eine übermäßige Expansion der Liquidität zugelassen. Wenn zuviel Geld in Umlauf gesetzt wird, schlägt sich das entweder in steigenden Verbraucherpreisen oder in steigenden Preisen für Aktien, Immobilien oder Unternehmensanleihen nieder. Fatalerweise habe sich die Fed nur darauf konzentriert, wie sich die Kosten für die Lebenshaltung entwickelten – wo es wenig Anlass zur Sorge und damit zum Gegensteuern gab. Die zweite These: Vermögensblasen lassen sich nicht nur identifizieren, es lässt sich auch berechnen, wie groß und wie nahe am Platzen sie jeweils sind. Smithers braucht sich nicht vorwerfen zu lassen, dass man im nachhinein immer klüger ist und seine Kritik daher unfair sei; er hatte schon frühzeitig die Dotcom-Blase identifiziert und vor ihren Gefahren gewarnt.
Zur Bewertung der Aktienmärkte verwendet Smithers zwei Statistiken: Die eine ist die sogenannte equity q-ratio, das Verhältnis des Marktwertes der Unternehmen (ohne Finanzsektor) zu ihrem Nettowert zu Wiederbeschaffungskosten, also eine Variante von Tobin’s q – je mehr der Wert von „q“ nach oben von der historischen Norm abweicht, desto stärker ist der Markt überbewertet.
Bei der anderen handelt es sich um die „CAPE“, die „cyclically adjusted price to earnings ratio“, die im Jahr 2000 durch Robert Shillers Buch „Irrational Exuberance“ populär wurde. CAPE teilt den aktuellen Marktwert der Unternehmen, die in Indices wie dem S&P 500 oder dem Dax enthalten sind, durch die durchschnittlichen Gewinne pro Aktie in den vergangenen zehn Jahren, hochgerechnet auf den heutigen Zeitpunkt mit der inzwischen eingetretenen Geldentwertung. Das so ermittelte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird mit seinem langfristigen Durchschnittswert verglichen – je mehr es von diesem nach oben abweicht, desto eher dürfte es sich um eine Blase handeln.
Smithers unterscheidet zwischen Preis und Wert, also zwischen Marktkursen und „fairen“ Kursen, die er mit Hilfe der beiden Methoden berechnet. Die Märkte tendieren dazu, um diese fairen Werte zu schwanken. Er gibt zu, dass Abweichungen nicht selten über sehr lange Perioden hinweg fortbestehen können. Wenn die Hausse-Signale aber sowohl eindeutig als auch stark sind, kommt es in der Folge stets zu Kurseinbrüchen – in den USA in den Jahren 1929, 1936, 1968 und 2000 (die folgende Grafik zeigt die aktuellen Werte der KGVs von Robert Shiller). Im Jahr 2007, als es beim S&P 500 einen ähnlichen Spitzenwert gab wie im Jahr 2000 (jeweils über 1500 Punkte), waren die Aktien zwar teuer, aber nicht so extrem wie damals: In der Zwischenzeit hatte sich nämlich der Realwert des Kapitals durch einbehaltene Gewinne kräftig erhöht; zudem war das Preisniveau in diesen sieben Jahren um 20,4 Prozent gestiegen.
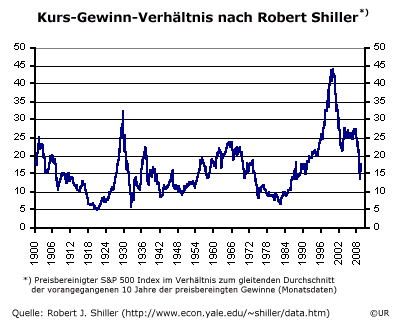
Uwe Richter kommt in der folgenden Graphik zu einem ähnlichen Ergebnis. Er setzt den Dax und den S&P 500 ins Verhältnis zu dem jeweiligen nominalen Sozialprodukt. Hier liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein Aktienindex nicht lange deutlich rascher steigen kann als der Output der Volkswirtschaft. Das Schaubild zeigt, erstens, dass die Aktienkurse in Deutschland in den Jahren 2000 und 2007 fast zwangsläufig einbrechen mussten, und dass, zweitens, wie bei Smithers, der amerikanische Markt 2007 nicht so überbewertet war wie im Jahr 2000.
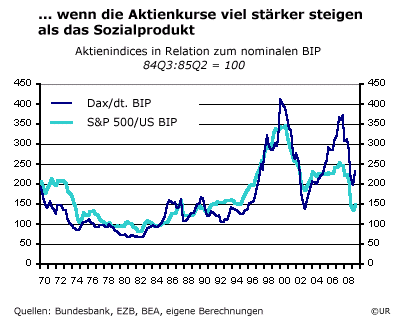
Was die Blasen an den Immobilienmärkten angeht, müssen sie sich nicht im Gleichschritt mit den Aktienkursen entwickeln. Während es in Japan in den achtziger Jahren auf beiden Märkten simultan zu Blasen gekommen war – übrigens ebenfalls bei sehr niedriger und daher nicht besorgniserregender Inflation der Verbraucherpreise -, waren es in den USA erst die Aktien, dann die Häuserpreise. Smithers macht die zweite Runde der „follies (der Torheiten) of the Federal Reserve“, also die expansive Politik nach dem Platzen der Dotcom-Blase und der leichten Rezession von 2001, für die Exzesse an den amerikanischen Immobilienmärkten verantwortlich. Auch die geringe Risikoscheu der Anleger, die sich in rekordniedrigen Risikoaufschlägen bei Unternehmensanleihen niederschlug, führt er auf diese „follies“ zurück.
Wie misst Smithers Übertreibungen bei Hauspreisen? Wann kommt es da zu Blasen? Anders als bei der Bewertung von Aktienmärkten mit der equity q-ratio sind die Wiederbeschaffungskosten, also die Baukosten, kein guter Gradmesser für den „wahren“ Wert von Häusern, weil die Kosten des Grundstücks einen so großen Anteil am Gesamtpreis einer Immobilie haben. Der Standardansatz in der ökonomischen Literatur, den auch Smithers verfolgt, ist an der Erschwinglichkeit von Immobilien ausgerichtet. Während Aktienkurse auf lange Sicht um ihren fairen Wert schwanken, sind Hauspreise langfristig an das verfügbare Einkommen der Haushalte gekoppelt. Auf kurze Sicht werden sie natürlich oft auch von Erwartungen über die künftigen Hauspreise getrieben, was zur Blasenbildung führen kann. Ergebnis: Wenn Häuser im Vergleich zum Einkommen der Käufer sehr teuer sind, ist einer Korrektur umso wahrscheinlicher, je größer die Diskrepanz wird.
Angenommen nun, eine Notenbank hätte eine Blase identifiziert, was sollte sie dagegen tun? Smithers plädiert für ein „leaning against the wind“, wie es die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) seit langem vorgeschlagen hat. Sie sollte also bereit sein, im Interesse der langfristigen Stabilität eine Rezession einzuleiten, indem sie, auch wenn die Verbraucherpreise aktuell stabil sein sollten, die Zinsen erhöht. Besser eine milde Rezession hinnehmen als sich jahrelang mit den unkontrollierbaren Folgen platzender Blasen und eines endlosen Entschuldungsprozesses („Deleveraging“) herumzuschlagen, in dessen Verlauf sich das Wachstum des Produktionspotentials und damit des allgemeinen Wohlstands deutlich vermindern kann, so wie wir es in Japan erlebt haben, und wie es in den USA wieder geschehen könnte. Vorbeugen ist besser als heilen, lautet Smithers‘ Devise.
Aber das ist leichter gesagt als getan. Nicht nur, dass es von politischer Seite einen Aufschrei gäbe, wenn die Notenbank bewusst eine Rezession und damit Arbeitslosigkeit herbeiführen würde, auch die Banken, die bislang zumindest vor allem an kurzfristigen Gewinnen interessiert sind, dürften Sturm laufen. Warum wohl hat nie jemand auf die BIZ gehört? Die Notenbanken bräuchten auf alle Fälle ein neues Mandat, wenn sie wirkungsvoll auf Assetpreise reagieren sollen. Wer gibt ihnen das?
Alternativ, oder zusätzlich, könnte man den Notenbanken neben der Zinsschraube ein zweites Instrument in die Hand geben. Vermögensblasen könnten sie durch eine antizyklische Variation der Eigenkapitalquoten bekämpfen – die Zinspolitik wäre wie bisher für die Stabilität der Verbraucherpreise zuständig, die Eigenkapitalpolitik für die Assetpreise. Smithers bezieht sich dabei auf den Geneva Report on the World Economy Nr. 11, der im Januar von Markus Brunnermeier, Andrew Crocket u.a veröffentlicht wurde.
So sollte es natürlich sein: für jedes Ziel ein separates Politikinstrument. Ich frage mich allerdings, ob es nicht auch eine separate Institution geben sollte, schon wegen der Interessenkonflikte zwischen Geldwertstabilität und wünschenswerten Assetpreis-Niveaus. Außerdem: Während der erforderliche Gesetzgebungsprozess in den USA schon schwierig genug sein dürfte, sind die politischen Hürden im Euroland noch einmal ein Stück höher – wir brauchten einen Maastrichtvertrag 2. Die Sache ist allerdings so dringend nicht, da das Kind ja schon in den Brunnen gefallen ist und die Gefahr neuer Blasen erst einmal gering ist. Besser eine handwerklich saubere neue wirtschaftspolitische Struktur als aus der Hüfte geschossen. Vorläufig reichen nationale Lösungen, etwa nach dem Vorbild Spaniens.
Ein Problem, das aus meiner Sicht nicht leicht zu lösen ist, besteht darin, dass der Besitz von Aktien für die Haushalte in manchen Ländern keine Rolle spielt, der von Immobilien und Unternehmensanleihen dagegen sehr wohl. Eine Zentralbank wie die EZB – oder auch eine neue Institution – müsste eine aggregierte Statistik entwickeln, in der die Signale der Märkte für Aktien, Immobilien und Anleihen nach ihrer Bedeutung gewichtet Eingang finden, so etwas wie einen „monetary conditions index“ für die Assetmärkte.
Was die Sache in der Währungsunion zusätzlich erschwert, sind die dramatisch auseinanderlaufenden Immobilienpreise. Wie die folgende Graphik zeigt, gab es in Spanien und Frankreich eine Hausse, in Deutschland dagegen eine leichte Deflation. Bisher bewegen sich die Aktienmärkte sehr synchron, die Wohnungsmärkte jedoch nicht im geringsten.
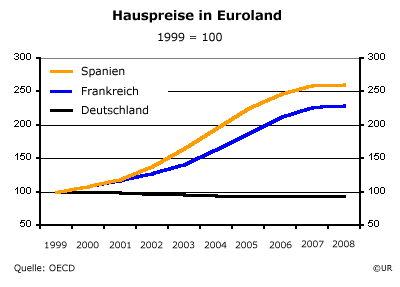
Per Saldo gab es vermutlich im Euroland keine Immobilienblase, gegen die etwas hätte getan werden müssen. Ich vermute, dass es dieses Problem in einigen Jahren allerdings nicht mehr geben wird. Was in den früheren Weichwährungsländern des Club Med zu beobachten war, dürfte vor allem eine strukturelle Anpassung an den deutlichen Rückgang der realen Hypothekenzinsen seit der Einführung des Euro gewesen sein. Von nun an wird es auch bei den Hauspreisen einen mehr oder minder ausgeprägten Gleichschritt geben.
Aber ich bin abgeschweift. Über diese Aspekte lässt sich Smithers, der ein gesundes amerikazentristisches (gibt es das Wort?) Weltbild hat, natürlich nicht aus. Was bleibt nach der Lektüre seines Buches als Erkenntnis? Es gibt immer wieder Assetpreis-Blasen, sie lassen sich identifizieren, und man kann verhindern, dass sie so groß werden. Und: Wir brauchen mindestens ein neues Politikinstrument. Die Diskussion hat gerade erst begonnen.