Was würde eigentlich passieren, wenn Griechenland einfach sich selbst überlassen bliebe? Bis Ende Mai müssen offenbar Staatsanleihen in Höhe von 20,5 Mrd. Euro am Markt untergebracht werden, was etwa 8 1/2 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Die jüngste 10-jährige Anleihe, mit einem Kupon von 6 1/4 Prozent, war fast dreifach überzeichnet, was zeigt, dass es bislang keine Probleme gibt. Wenn die Griechen genug zahlen – genauer: versprechen zu zahlen -, werden sie auch in der Zukunft Abnehmer für ihre Schulden finden. Nur tut es natürlich weh, wenn die Zinsbelastung fast doppelt so hoch ist wie in Deutschland (zehnjährige Bundesanleihen haben zur Zeit eine Rendite von 3,18 Prozent).
Griechenland ist kein besonders armes Land: Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war 2009 nur rund 27 Prozent niedriger als das deutsche. Die durchschnittlichen Wachstumsraten waren im vergangenen Jahrzehnt nicht weniger als drei Prozentpunkte höher als in Deutschland (3,5 Prozent verglichen mit 0,5 Prozent), und die Arbeitslosigkeit liegt bei „nur“ 10,6 Prozent. Auch wenn von nun an mit aller Macht gespart werden muss, bedeutet das keine existenzielle Bedrohung. Allein der Übergang von der exzessiven Schuldenwirtschaft zu geordneteren Verhältnissen wird sehr weh tun. Es wird vor allem dann einen deflationären Schock geben, den die Gesellschaft möglicherweise nicht verkraftet, wenn, wie geplant, versucht wird, das staatliche Defizit innerhalb von drei Jahren von zuletzt 13 Prozent auf etwa 3 Prozent des BIP herunter zu fahren. Was spricht dagegen, sich dafür zwei oder drei Jahre mehr Zeit zu nehmen? Für die Anleger kommt es nur darauf an, dass das Sparprogramm glaubhaft ist, was vor allem heißt, dass es von der Bevölkerung mitgetragen wird. Wenn durch eine Streckung Straßenkämpfe und Generalstreiks vermieden werden können, wird sich das positiv auf die Höhe der Zinsen und den Schuldendienst auswirken.
Ich denke, dass Griechenland zum Einen weiterhin Zugang zum Kapitalmarkt haben wird, und zweitens schon aus Eigeninteresse seinen Gürtel enger schnallen wird, also in der Tat keine Hilfe von außen braucht, abgesehen davon, dass der Artikel 125(1) des Vertrags von Lissabon das verbietet. Eine kreative Auslegung des Vertragstextes ist sicher denkbar und vermutlich auch bereits im Gange, ich halte das aber für überflüssig. Zudem könnte es einen gefährlichen Präzedenzfall geben, der Spanien, Portugal und vielleicht sogar Italien ermutigen könnte, es auch einmal zu versuchen.
Die Schulden lassen sich im jetzigen System für ein einzelnes Land nicht weginflationieren und sind daher für die kommenden Generationen eine schwere reale Last. Keine Regierung wird es sich leisten können, sie weiter ausufern zu lassen. Da es nicht möglich ist, gegenüber den anderen Ländern in der Währungsunion, also den Hauptgläubigern, abzuwerten, wird die Neuverschuldung gegenüber dem Ausland dadurch zurückgehen müssen, dass das inländische Kostenniveau gesenkt wird: Auf diese Weise werden weniger Waren und Dienstleistungen importiert und gleichzeitig mehr exportiert. Das vermindert automatisch die Nettokapitalimporte und macht das Land kreditwürdiger. Im Jahr 2009 hatten diese Kapitalimporte ebenfalls rund 13 Prozent des BIP erreicht; die Bruttoschuldenquote des Staates nähert sich mit Riesenschritten der 100 Prozent-Marke.
Wie kann das Kostenniveau gesenkt werden? Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass die Kapitalkosten zunächst erst einmal steigen (schwacher Aktienmarkt, höhere Zinsen auf Fremdkapital). Auch bei den relativen Importkosten lässt sich wegen des festen Wechselkurses innerhalb der Währungsunion nichts machen. Es führt daher kein Weg daran vorbei, dass die Lohnstückkosten, der bei weitem wichtigste volkswirtschaftliche Kostenblock, deutlich sinken müssen. Idealerweise kann das durch eine kräftige Zunahme der Produktivität erreicht werden, ist aber im Fall Griechenland eher unwahrscheinlich. Das erfordert nämlich entweder eine bessere Auslastung der Kapazitäten oder einen neuen Investitionsboom, wonach es wegen des unvermeidlichen Einbruchs der Inlandsnachfrage überhaupt nicht aussieht.
Die Nominallöhne und die Einkommen insgesamt werden also fallen. Für die anderen Länder des Euroraums bedeutet diese extrem pro-zyklische Politik einen Rückgang ihrer Exportüberschüsse gegenüber Griechenland und damit tendenziell Einbußen bei der Beschäftigung. Glücklicherweise ist Griechenland aber nur ein kleines Land, dessen Sparprogramm von den anderen kaum bemerkt werden dürfte. Per Saldo ist die Krise Griechenlands eine Art Konjunkturprogramm für die Währungsunion, weil sie hauptverantwortlich ist für die jüngste Abwertung des Euro gegenüber Dollar, Yen und Renminbi.
Die deutschen Auftragseingänge aus dem Nicht-EWU-Raum sind beispielsweise in den drei Monaten bis Januar real mit einer Jahresrate von 20,0 Prozent gestiegen und lagen damit um nicht weniger als 30,4 Prozent über ihrem Vorjahreswert. Auch wenn das nicht allein auf die Abwertung des Euro zurückzuführen ist, hat sie jedenfalls nicht geschadet.
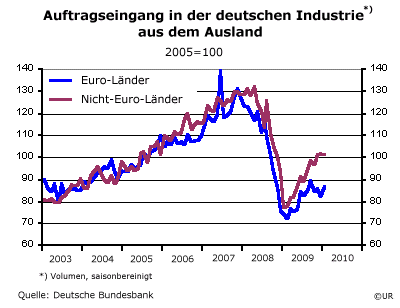
Überhaupt wäre es das Beste für Griechenland und seine Gläubiger, wenn die Konjunktur in den finanziell relativ gesunden Ländern der Währungsunion Fahrt aufnähme. Das würde Griechenland den notwendigen Strukturwandel in Richtung Auslandsnachfrage erheblich erleichtern, vor allem im Hinblick auf den Arbeitsmarkt. Nach den deutschen Auftragseingängen der letzten Woche, den Zahlen vom Montag zur Industrieproduktion sowie den diversen Umfrageindices für die Währungsunion insgesamt scheinen wir mindestens auf Sicht von zwei Quartalen vor einem recht dynamischem Aufschwung zu stehen. Griechenland ist vielleicht weniger als befürchtet auf Hilfspakete der europäischen Partner angewiesen.
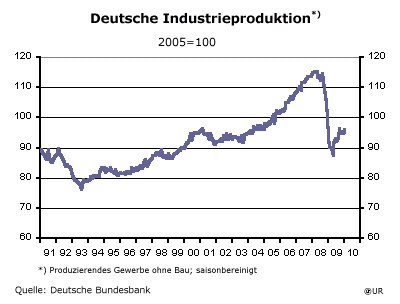
Ich will nicht naiv erscheinen. Wir müssen damit rechnen, dass auch die übrigen Länder der Währungsunion, ebenso wie andere große Industrieländer, daran gehen werden, ihre Finanzen zu „konsolidieren“, sobald Anzeichen für einen sich selbst tragenden Aufschwung zu sehen sind. Große Staatsdefizite gelten vielfach als Regierungsversagen und nicht als notwendige, wenn auch nur vorübergehende Kompensation für den Ausfall der privaten Nachfrage. Das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, sind die restriktiven Maßnahmen Japans im Jahr 1997: Kaum hatte der Aufschwung begonnen, wurde er schon wieder abgewürgt. Die Geschichte könnte sich wiederholen.
Was die Währungsunion und den Euro angeht, kann ich nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Denn dann gerieten schon bald andere Länder ins Schussfeld der Anleger. Sie haben ein Gewicht, das mehr als zehn mal größer ist als das von Griechenland. Wenn die alle ihre Gürtel genau so eng schnallen würden, wäre das Ende des Euro nicht mehr fern.
Das Gute an der jetzigen Krise ist, dass sie die Konstruktionsmängel der Währungsunion erbarmungslos offen gelegt hat. Die Maastricht-Kriterien sind, da de facto unverbindlich, nicht dasselbe wie eine gemeinsame Finanzpolitik mit Biss. Und die ist nicht möglich ohne den Willen der Euroländer, weiter in Richtung politischer Union voran zu gehen. Die Währungsunion gleicht einem Radfahrer: Wenn er aufhört zu strampeln, fällt er um.