Die neuen detaillierten Zahlen zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) des vergangenen Quartals zeigen einmal mehr, wie sehr unser Land vom Außenhandel abhängt. Obwohl die inländische Nachfrage um 0,8 Prozent niedriger als im dritten Quartal 2011 war, gab es im gleichen Zeitraum dennoch einen Anstieg des realen BIP um 0,9 Prozent. Der Grund ist die immer noch sehr robuste Auslandsnachfrage: Die Exporte von Waren und Dienstleistungen übertrafen ihren Vorjahreswert um 5,0 Prozent! Woran genau das liegt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Der relativ schwache Euro, die beträchtliche Unterauslastung der Kapazitäten, das vergleichsweise rasche Wachstum der Weltwirtschaft, vor allem der Schwellenländer, spielen ebenso eine Rolle wie der offenbar konjunkturresistente Produktmix der deutschen Unternehmen.
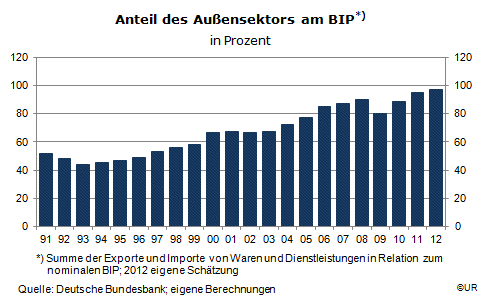
Nicht nur in letzter Zeit, sondern auch im Trend wird der Außensektor ständig wichtiger. Im vergangenen Jahrzehnt hat die reale Inlandsnachfrage im Durchschnitt nur um 0,7 Prozent jährlich zugenommen, die Ausfuhren dagegen um 5,5 Prozent. Die Einfuhren stiegen im Trend „nur“ um 4,8 Prozent. Das bedeutet, dass die Integration in die Weltwirtschaft rapide zunimmt und der Tag nicht mehr fern ist, an dem die Summe aus Exporten und Importen größer ist als das Sozialprodukt, so wie das heute bereits in Singapur oder Hongkong und generell in kleinen offenen Volkswirtschaften der Fall ist.
Das ist aus mindestens zwei Gründen kein Nachteil: Zum Einen expandiert die Weltwirtschaft wegen der Aufholprozesse in den armen und bevölkerungsreichen Ländern im Trend deutlich rascher als die deutsche Wirtschaft, zum Anderen sind die Konjunkturausschläge im Ausland geringer als im Inland – was das unternehmerische Planen erleichtert und Risiken mindert. Außerdem zwingen offene Grenzen die Unternehmen, ständig ihre Produktpalette auf den neuesten Stand zu bringen und ihre Kosten im Griff zu behalten. Wer da nicht mithalten kann, scheidet aus. Monopolrenten gibt es nicht, oder nur sehr selten.
Eine immer intensivere internationale Arbeitsteilung hat natürlich auch Nachteile: Beispielsweise kann der Wandel der Produktionsstruktur so dynamisch verlaufen, dass kurzfristig mehr Branchen verschwinden als neue entstehen. Außerdem wird der deutsche Arbeitsmarkt immer stärker durch das Ausland bestimmt. Vor allem die weniger qualifizierten Arbeitnehmer wissen ein Lied davon zu singen. Tendenziell geht es in Richtung eines Weltmarkts für einfache Jobs, also niedrigere Löhne in einem Land wie dem unsrigen, wenn die Gewerkschaften und der Staat (in Form von Mindestlöhnen) nicht gegenhalten können.
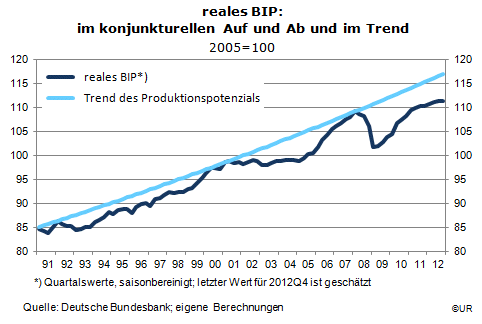
Für das Gesamtjahr 2012 lässt sich jetzt mit einiger Sicherheit vorhersagen, dass das reale Sozialprodukt um etwa 0,9 Prozent höher sein wird als 2011. Auf der sogenannten Entstehungsseite ist der Sektor „Information und Kommunikation“ wieder einmal der bei Weitem dynamischste. Leider hat er nur einen Anteil von 3 Prozent an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Immerhin, sein Output hat gegenüber dem zweiten Quartal um 1,8 Prozent zugelegt und ist damit seit 2005 (dem aktuellen Basisjahr, das die Bundesbank für die VGR verwendet) um stolze 43 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu nehmen sich die 11 Prozent des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) fast mickrig aus, und erst recht die 3 Prozent der Bauwirtschaft. Auch die neuen Zahlen liefern keinen Beleg dafür, dass es am Bau wegen der Fluchtgelder aus dem Mittelmeerraum inzwischen brummt; de facto herrscht seit 2005 Stagnation.
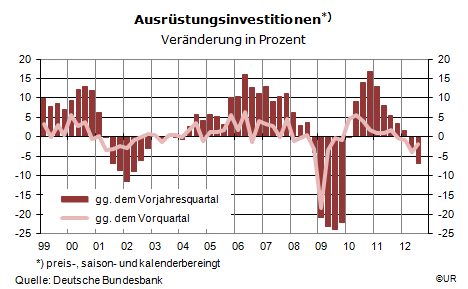
Bei den Ausrüstungsinvestitionen sah es im dritten Quartal besonders schlecht aus. Real sind sie gegenüber dem zweiten Quartal um 2,0 Prozent, und gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,0 Prozent gefallen. Zusammen mit der beruflichen Qualifikation der Bevölkerung und dem Standard der Infrastruktur sind die Ausgaben für Maschinen und Anlagen die entscheidenden Determinanten für die Produktivität und damit für den künftigen Wohlstand. Seit 2005 sind sie im Schnitt nur um 1,2 Prozent jährlich gestiegen.
So sehr ich im Allgemeinen dagegen bin, dass der Staat den Leuten vorschreibt, wie sie ihr Geld ausgeben sollten, so sehr bin ich in manchen Fällen dafür, dass er eingreift, etwa wenn es negative externe Effekte durch Lärm oder Luftverschmutzung gibt, oder wenn, wie zurzeit, die Investitionen einbrechen. Von der Lage der öffentlichen Haushalte her besteht durchaus Spielraum für eine befristete finanzielle Förderung des Wachstums. Weil das indirekt auch die Exporte der Problemländer des Mittelmeers stützt, wäre das nicht zuletzt ein Beitrag zur Stabilisierung des Euro. Außerdem: Noch nie zuvor konnte sich der Bund zu langfristigen Realzinsen von nahezu null Prozent verschulden. Da die Erträge von Investitionen bei einem klug konzipierten Anreizsystem höher sein dürften als null, sollte er die günstige Situation nutzen.
Nur im Vergleich zu anderen Ländern der Währungsunion sieht es konjunkturell in Deutschland einigermaßen gut aus, für sich genommen schrammt die deutsche Volkswirtschaft am Rand einer Rezession entlang. Nach der mickrigen Zuwachsrate des realen BIP von 0,2 Prozent im dritten Quartal (gegenüber dem Zweiten) dürfte es im vierten zu einem leichten Rückgang der Produktion kommen. Dafür spricht der Einbruch der Industrieproduktion und der Anstieg der (saisonbereinigten) Arbeitslosenzahlen. Die Outputlücke weitet sich demnach beschleunigt aus. Es gibt daher kaum Inflationsrisiken, sodass die EZB weiterhin einen extrem expansiven Kurs fahren kann. Die langfristigen Zinsen dürften nicht zuletzt wegen der Geldpolitik niedrig bleiben (ein anderer Grund ist das sehr gute Rating deutscher Schuldner).
Wie wird es weitergehen? Ich glaube nicht, dass es noch einmal zu einer Rezession nach dem Muster von 2008/2009 kommen wird. Aktien- und Immobilienblasen, die platzen könnten, sind bereits geplatzt, und die Weltwirtschaft außerhalb der Währungsunion expandiert zwar langsamer als 2010 und 2011, unmittelbar nach der globalen Rezession, aber immer noch mit einer Verlaufsrate von gut 2 Prozent. In ihrem neuen Economic Outlook prognostiziert die OECD für den realen Welthandel in diesem Jahr eine Zuwachsrate von 2,8 Prozent, gefolgt von plus 4,7 Prozent im nächsten. Aus deutscher Sicht sind das gute Zahlen. Der Rückgang der Ifo-Indikatoren und der Auftragseingänge in der Industrie ist zudem bei Weitem nicht so stark wie damals, bisher jedenfalls.
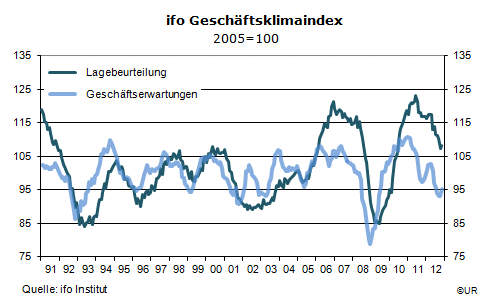
Gefahr geht vor allem von den Rezessionen in Italien und Spanien aus, wo der forcierte Strukturwandel zusammen mit pro-zyklischer Finanzpolitik sich zur Zeit – und vielleicht auch noch für länger – in einem scharfen Rückgang der Nachfrage und Beschäftigung niederschlägt. Die Lage soll sich spätestens 2014 bessern, aber wie genau das gehen kann, ist mehr als unsicher. Ein schwacher Euro und ein kräftiges Wachstum in Deutschland, den übrigen europäischen Gläubigerländern und in den Schwellenländern würden helfen, ebenso wie konkrete Schritte in Richtung Bankenunion, weil dadurch die langfristigen Zinsen in der Peripherie der Währungsunion endlich auf vertretbare Niveaus sinken würden. Im Großen und Ganzen ist das Licht am Ende des Tunnels noch sehr schwach.