Ich finde es ziemlich erstaunlich, dass die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland trotz der teilweise drastischen Rückgänge der Produktion während der vergangenen fünf Jahre und zuletzt im 4. Quartal 2012 stetig gestiegen ist und nach wie vor steigt. Soweit ich mich erinnern kann, gab es das noch nie. Das Land erlebt ein Beschäftigungswunder. Gleichzeitig stagniert die Produktivität (der Output je Arbeitsstunde) in diesem Zeitraum, also seit dem Beginn der Finanzkrise und der Großen Rezession. Auch das ist neu: In früheren Rezessionen nahm die Produktivität fast immer weiter zu – bei schlechter Auftragslage waren die Beschäftigten der Anpassungsparameter. No more.
In den USA ist es genau umgekehrt. Die Produktivität expandierte von damals bis heute mit jährlichen Raten von 1,1 Prozent, die Anzahl der Beschäftigten ist aber im Durchschnitt jährlich um 0,5 Prozent zurückgegangen und lag im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent unter dem Stand vor der Rezession. Das Gespenst einer „jobless recovery“ geht um. Hierzulande gab es dagegen von 2007 bis 2012 einen Zuwachs von nicht weniger als 4,4 Prozent.
Schröder, Hartz, Rürup, Riester sowie Tarifpartner, die seit einiger Zeit mehr auf Kooperation als auf Konfrontation setzen, haben uns einen Arbeitsmarkt beschert, der seit 2007 pro Jahr 0,9 Prozent mehr Jobs generiert: Es ist offenbar unter den neuen Rahmenbedingungen leicht, Arbeit zu finden, aber bei der Effizienz treten wir auf der Stelle. Aus dem kranken Mann Europas, dem es nicht gelungen war, in den fünfzehn Jahren bis 2006 einen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz zu schaffen, ist eine Jobmaschine geworden. Auf einmal gilt die deutsche Volkswirtschaft als die dynamischste Europas – auch wenn sich bei der Produktivität so gut wie nichts tut, nicht zuletzt wohl, weil die neuen Jobs vielfach im Niedriglohnsektor entstanden sind. Im Grunde ist es nicht so toll, wenn ständig mehr gearbeitet wird, pro Stunde aber nicht mehr herauskommt als in der Vergangenheit. Wo bleibt der technische Fortschritt?
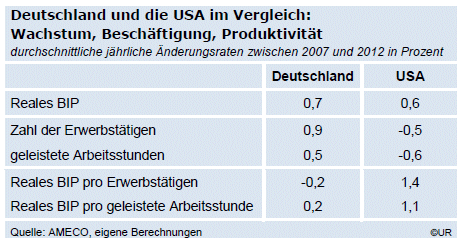
In den USA wird befürchtet, dass, wenn das reale BIP künftig mit jährlichen Raten von 2 bis 2,5 Prozent expandieren wird, dieser Fortschritt vor allem auf eine immer effizientere Produktion zurückzuführen ist. Netto entstehen dann möglicherweise zu wenig neue Arbeitsplätze. Da die Bevölkerung nach wie vor jährlich um etwa 1,0 Prozent zunimmt, müsste auch das Jobangebot in diesem Tempo steigen, wenn der Anteil der Beschäftigten an der Bevölkerung einigermaßen stabil bleiben soll. Das tut er aber nicht.
In einem lesenswerten kleinen Buch („Race against the Machine„, 2011) weisen Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee, zwei Ökonomen vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), darauf hin, dass sich die amerikanische Bevölkerung in dem Jahrzehnt seit 2000 um 30 Millionen vergrößert hat. Und normalerweise hätten 18 Millionen neue Jobs geschaffen werden müssen. Tatsächlich hat sich die Beschäftigung aber so gut wie gar nicht erhöht, so dass die Erwerbsquote, der Anteil der Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung, von 64 auf 58 Prozent gesunken ist.
Gegenwärtig liegt die Arbeitslosenquote in den USA bei 7,9 Prozent und damit zwar um Einiges unter dem zyklischen 10,0-Prozent-Hoch von Oktober 2009, die sogenannte Unterbeschäftigungsquote ist aber viel höher, nämlich 14,4 Prozent: Bei ihr werden u.a. auch diejenigen mitgezählt, die nicht mehr aktiv nach einem Arbeitsplatz suchen – weil sie das für aussichtslos halten. Mit anderen Worten, die Situation ist nicht viel besser als in den Krisenregionen Eurolands und erklärt, weshalb die Fed weiter Gas geben will. Da der Deflator des privaten Verbrauchs, der als ihr wichtigstes Inflationsmaß gilt, im Vorjahresvergleich inzwischen auf 1,2 Prozent gesunken und damit eher zu niedrig als zu hoch ist, besteht Handlungsspielraum.
Die Fed kauft zurzeit monatlich Aktiva in Höhe von 85 Mrd. Dollar und bläht damit ihre Bilanz aggressiv auf. Durch das Fluten der Märkte mit billigem Zentralbankgeld sollen Unternehmen und Haushalte animiert werden, Kredite aufzunehmen und endlich wieder mehr auszugeben. Solange der Schuldenabbau bei den Haushalten im Vordergrund steht und die Unternehmen angesichts großer Kapazitätsreserven keinen Anlass sehen, ihre Investitionen deutlich zu steigern, schlägt diese Medizin nicht richtig an. Auch der Staat hat sich die Konsolidierung seines Haushalts auf die Fahne geschrieben und betreibt – nicht ganz freiwillig – eine restriktive Politik. In diesem Jahr dürften die staatlichen Ausgaben real erneut zurückgehen (um rund 1,5 Prozent im Vergleich zu 2012). Trotzdem wird das Defizit des Gesamtstaates laut Internationalem Währungsfonds immer noch bei 7,3 Prozent des nominalen BIP liegen, die Staatsschulden sogar bei 111,7 Prozent (zum Vergleich die deutschen Zahlen: -0,4 und 81,5 Prozent). Insgesamt dürfte das reale BIP der USA 2013 gegenüber 2012 nach meinen Schätzungen nur um 1,5 Prozent zunehmen. Eine nachhaltige Wende am Arbeitsmarkt ist daher nicht zu erwarten.
Die amerikanische Endnachfrage geht seit einiger Zeit nicht zuletzt deshalb kaum über den Produktivitätsfortschritt hinaus, weil die Haushaltseinkommen im Durchschnitt (Median) vier Jahre in Folge gesunken sind: Ende 2011 – neuere Zahlen gibt es nicht – waren sie zudem nicht höher als 1995. Die Haushalte sind stark verunsichert und sind nicht mehr der Konjunkturmotor, der sie in der Vergangenheit stets waren. Nicht nur am unteren Ende der Einkommensskala gehen massenhaft Routinejobs verloren, auch in der breiten Mitte haben technischer Fortschritt und immer intensivere internationale Arbeitsteilung zu Jobverlusten und rückläufigen Einkommen geführt. Die Gewinner sind Leute mit guter Ausbildung, die Besitzer von Kapitalvermögen und die Superstars – die USA entwickeln sich zu einer „winner takes all“-Gesellschaft, in der eine zahlenmäßig kleine Gruppe unverhältnismäßig viel verdient.
Für die Konjunktur, die von robust steigenden Masseneinkommen lebt, sind das schlechte Nachrichten. Die Einkommensverteilung ist zu ungleichmäßig. Die beiden MIT-Autoren schlagen vor, das Problem durch Angebotspolitik zu lösen, also durch bessere Ausbildung, vermehrte Einwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte, die Förderung des Unternehmertums, eine bessere Infrastruktur sowie die Reform von Gesetzen, Regulierungen und Steuern mit dem Ziel, die Wirtschaft flexibler zu machen. Eine Umverteilung durch progressivere Einkommensteuern, höhere Mindestlöhne oder Handelsbarrieren (gegen die Billigkonkurrenz aus Asien) wird dagegen gar nicht erst erörtert. Das wäre selbst für die liberalen Ostküstenökonomen vermutlich zu unamerikanisch.
In Deutschland hatte der Aufschwung nach der Rezession von 2008/2009 ganz andere Effekte auf die Einkommensverteilung: Die Einkommen der Arbeitnehmer sind vom ersten Quartal 2009 bis zum vierten Quartal 2012 mit einer durchschnittlichen Rate von 3,3 Prozent gestiegen, real also um 1,6 Prozent jährlich. Das dürfte der wichtigste Grund dafür sein, weshalb die Verbraucher weiterhin so optimistisch in die Zukunft schauen – abgesehen davon, dass sie sich viel weniger für Immobilien verschuldet haben als in anderen Ländern und jetzt nicht zum Sparen gezwungen sind.
Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich so stark verbessert, dass der Anteil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am Volkseinkommen seit zwei Jahren kräftig sinkt und der Anteil der Arbeitnehmereinkommen entsprechend steigt. Nicht das Kapital ist knapp, sondern eher das Angebot an Arbeit. Angesichts der immer noch niedrigen Kapazitätsauslastung und hohen Arbeitslosenquote (6,9 Prozent) gibt es aber zurzeit weder beim Einen noch beim Anderen wirkliche Engpässe.
Ich vermute allerdings, dass das Beschäftigungswunder trotzdem nicht mehr lange anhalten wird. Dafür ist die Erwerbstätigenquote in den letzten Jahren zu sehr gestiegen. Auch die Beschleunigung der Lohninflation hat tendenziell gegenläufige Effekte auf die Beschäftigung. Ich kann vor allem nicht erkennen, warum die Produktivität in einem Land, das voll in die internationale Arbeitsteilung eingebunden ist und eine höhere Investitionsquote hat als beispielsweise die USA, nicht wieder kräftiger zunehmen sollte.
In den zehn Jahren bis zum ersten Quartal 2008 hat der deutsche Output je Arbeitsstunde im Trend jährlich um 1,6 Prozent zugenommen, und ist heute immer noch auf dem Niveau von Anfang 2008, ist also per Saldo seit fünf Jahren unverändert. In der Industrie ist es in den fünf Jahren sogar zu einem Rückgang von 3,7 Prozent gekommen! Es kann ja nicht sein, dass der technische Fortschritt auf einmal einen großen Bogen um Deutschland gemacht hat, oder dass es Anzeichen für einen Strukturbruch gegeben hätte, oder dass den Unternehmern und ihren Angestellten die Ideen ausgegangen wären.
Fragt sich also, wann es auch hierzulande wieder einmal ein Produktivitätswunder gibt.