Am Montag hatte Wolfgang Münchau in der Financial Times die These aufgestellt, dass die Euro-Krise nicht beendet werden kann, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern. Den Krisenländern werde es nicht gleichzeitig gelingen, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern – indem sie Ressourcen von den Binnensektoren in die Außensektoren umlenken und gegenüber den Handelspartnern real abwerten – und die staatlichen Schulden auf ein erträgliches Niveau zu reduzieren. Da es keinen Plan gebe, mit dem das bewerkstelligt werden kann, wird die Euro-Krise weitergehen. Die Marktteilnehmer, die in letzter Zeit eine Liebesaffäre mit dem Euro angefangen haben, machten daher einen Fehler.
Finde ich nicht. Die Umlenkung der Ressourcen läuft inzwischen auf Hochtouren. Vereinfacht gesagt, die Löhne und Gewinne in den Sektoren, die mit dem Ausland konkurrieren (die für den Export produzieren oder Importe ersetzen) steigen rascher als in den Binnensektoren, etwa der Bauwirtschaft. Zudem nehmen die Löhne, bereinigt um Produktivitätseffekte, also die sogenannten Lohnstückkosten, in der Gesamtwirtschaft langsamer zu – oder sinken seit einigen Jahren sogar – als in den anderen Euro-Ländern. Die relativen Preise verändern sich sowohl im Inland als auch gegenüber dem Ausland. So muss es sein.
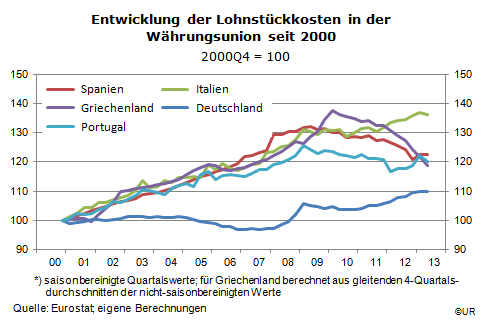
Der Erfolg dieser Strategien zeigt sich unter anderem daran, dass sich die Leistungsbilanzen von Italien und Spanien, den Ländern, auf die es wegen ihrer Größe letztlich ankommt, stark verbessert haben. Gab es vor der Krise, im Jahr 2008, noch Defizite in Höhe von 2,9 und 9,6 Prozent des BIP, rechnet der Internationale Währungsfonds in diesem Jahr für Italien mit einer ausgeglichenen Bilanz und für Spanien mit einem Überschuss von 1,4 Prozent. Griechenland hat sein Defizit im selben Zeitraum von 14,9 (!) auf ein Prozent reduziert, Portugal konnte sein Defizit von 12,6 in einen Überschuss von 0,9 Prozent verwandeln. In Irland gibt es ebenfalls inzwischen einen positiven Saldo (2,3 Prozent). Nur in Frankreich will es nicht so recht klappen – aber das ist offiziell ja auch kein Krisenland. Für die Folgejahre rechnet der IWF durchweg mit zunehmenden Überschüssen.
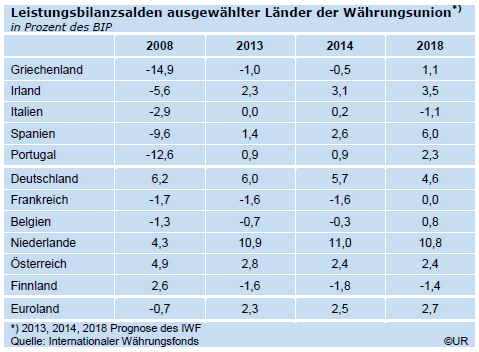
Münchau moniert, dass sich Euroland auf Kosten der übrigen Welt saniere. Aber nichts ist normaler als das, wenn die Wachstumsunterschiede so groß sind, wie sie sind: Das reale BIP der Welt expandiert laut IWF 2013 im Vorjahresvergleich mit einer Rate von 2,9 Prozent, Eurolands BIP aber schrumpft um 0,4 Prozent. Die Weltwirtschaft wird verkraften, was sich bei den Leistungsbilanzen tut. Zudem vermindert sich ja auch das Risiko, dass ein Euro-Crash die globale Wirtschaft eines Tages aus der Bahn wirft. Ich habe im Übrigen noch nie gehört, dass sich die US-Regierung bei ihrer Wirtschaftspolitik um die Interessen der übrigen Welt Gedanken macht.
Ein positiver Saldo in der Leistungsbilanz bedeutet im Übrigen, dass ein Land netto ein Kapitalexporteur ist und damit seine Auslandsschulden abbaut (das gilt für die Krisenländer) oder sein Auslandsvermögen weiter erhöht (Deutschland, Niederlande). Gläubiger freuen sich bekanntlich, wenn Schuldner gesunden. Wie wir am Beispiel Japans sehen, nehmen Anleger auch gewaltige Staatsdefizite hin, wenn ein Land nicht auf Nettokapitalimporte aus dem Rest der Welt angewiesen ist: Obwohl die Bruttoschulden dort in diesem Jahr 244 Prozent des BIP erreichen, liegen die Renditen zehnjähriger Papiere („JGBs“) zur Zeit bei nur 0,6 Prozent. Der Rückgang der zehnjährigen italienischen und spanischen Renditen von über sieben Prozent vor nicht allzu langer Zeit auf etwas über vier Prozent heute ist für mich ein Zeichen, dass den Regierungen Italiens und Spaniens zugetraut wird, dass sie ihre Schulden bedienen können.
Es fällt ihnen natürlich nicht leicht. Noch steigen die Schuldenquoten, weil das nominale Sozialprodukt entweder nur langsam zunimmt oder sogar zurückgeht, während die staatlichen Defizite einfach nicht verschwinden wollen. Die Regierungen der Krisenländer verfolgen teilweise eine extrem pro-zyklische Finanzpolitik: Sie versuchen die Ausgaben einzuschränken und gleichzeitig die Einnahmen zu steigern. Damit bremsen sie die Konjunktur. Tendenziell führt langsames Wirtschaftswachstum bekanntlich zu steigenden Defiziten im Staatshaushalt.
Spanien liefert für diesen Zusammenhang ein besonders dramatisches Beispiel: 2012 war das Sozialprodukt gegenüber 2011 um 1,7 Prozent gesunken, das staatliche Defizit belief sich 2012 auf 10,6 Prozent – es hatte gegenüber dem Vorjahr weiter zugenommen. Von 2011 auf 2012 erhöhte sich dadurch die Schuldenquote des Staates von 70,4 auf 85,9 Prozent des Sozialprodukts und hatte damit ein gefährliches Niveau erreicht. Vor der Krise lag die spanische Quote weit unter der Marke von 60 Prozent, der Schuldenobergrenze im Maastricht-Vertrag, und das Land galt als wirtschaftspolitischer Musterschüler.
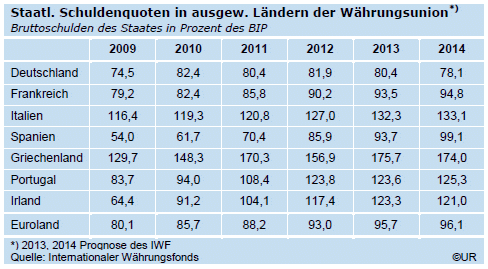
Die Krisenländer helfen sich angesichts ihrer Schuldenberge damit, dass sie die Laufzeit der neuen Verbindlichkeiten stark verkürzen, teilweise auf bis zu drei Monaten. Damit profitieren sie von der Niedrigzinspolitik der EZB. Selbst Griechenland als schlechtester Schuldner kann sich Geld auf drei Monate zu rund vier Prozent leihen. Auch bei den europäischen Rettungsmechanismen – mit ihrer guten Bonität – sind Mittel preiswert zu bekommen, vorausgesetzt natürlich, dass sie die finanz- und strukturpolitischen Auflagen der Kreditgeber erfüllen – oder versprechen, sie zu erfüllen.
Für den Moment ist der Schuldendienst daher ein nicht so großes Problem, aber mit solider Haushaltsführung hat das nichts zu tun. Ebenso wenig kann man darüber glücklich sein, dass die EZB vermutlich auf Jahre hinaus nicht in der Lage sein wird, die Zinsen zu erhöhen. Die Staatsschuldenkrise wäre sofort zurück. Die Zinsen dürfen erst dann steigen, wenn die Konjunktur so gut läuft, dass die Haushaltsdefizite von allein verschwinden. Die EZB ist daher nicht so unabhängig, wie wir uns das wünschen. Sie ist de facto zu einem sogenannten Fiscal Agent geworden – sie muss, gewollt oder ungewollt – den europäischen Finanzpolitikern Flankenschutz geben.
Insofern hat Münchau recht: Es muss noch etwas Grundlegendes geschehen, damit die Euro-Krise endlich überwunden wird. Die institutionellen Rahmenbedingungen müssen nachhaltig gestärkt werden, damit aus dem jetzigen, nach wie vor anfälligen Währungssystem eine echte Währungsunion werden kann. Dazu gehören eine Vereinbarung über die Lastenverteilung bei der Abwicklung von Banken, eine eurolandweite Einlagensicherung, für die Rettungsfonds belastbare Durchgriffsmöglichkeiten auf die Finanz- und Strukturpolitik der Schuldnerländer, größere Schritte in Richtung Transfers von den reichen an die armen und/oder überschuldeten Länder, das teilweise Streichen von Staatsschulden – wenn auch nur in Form einer Streckung des Zins- und Tilgungsdienstes.
Es ist ein ziemliches Programm, und ich muss zugeben, dass auch mir, als ausgewiesenem Eurofan, bänglich wird, wenn ich mir die Liste der Probleme ansehe, die noch gelöst werden müssen. Ich kann nur hoffen, dass es schnell zu Fortschritten kommt. Euro- und fremdenfeindliche Parteien sind in Straßburg, Brüssel und in zahlreichen nationalen Hauptstädten auf dem Vormarsch. Für Manche sind die 19 Millionen Arbeitslosen ein Argument, dass der Euro abgeschafft werden sollte.