Schön, wenn man Vorurteile hat. Am Sonntag hatte Lisa Nienhaus in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Politik der EZB auf’s Korn genommen. Ihre These: Versucht eine Notenbank – wie zur Zeit die EZB mit ihrem quantitative easing – durch eine expansive Politik de facto den Außenwert der Währung abzusenken, mag das neue Arbeitsplätze schaffen und sogar höhere Löhne mit sich bringen, aber das wird überkompensiert durch ein verlangsamtes Wachstum der Produktivität, also des allgemeinen Wohlstands: „So schafft eine solche Situation Faulheit.“ Statt sich anzustrengen und attraktive Produkte auf den Markt zu bringen, werden Nachteile im internationalen Wettbewerb einfach durch Preissenkungen ausgeglichen. Das ist für sie das italienische Modell, das inzwischen das Modell Eurolands geworden sei. Aus welchem Land kommt noch mal Mario Draghi?
Mark Schieritz hatte diesen Artikel schon am Montag hier im Herdentrieb kommentiert. Ihn störte, dass eine feste Währung einen stimulierenden Effekt auf die Produktivität haben solle, dass aber höhere Löhne nicht das Gleiche bewirkten – auch sie zwingen bekanntlich die Unternehmer, sich mehr anzustrengen, wenn sie sich am Markt behaupten wollen. Das Eine ist ein externer Effekt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, das Andere ein interner, qualitativ gibt es keinen Unterschied.
Abgesehen davon, dass sich die nominalen handelsgewogenen Wechselkurse von Italien und Deutschland seit 1996 vollkommen synchron bewegen, Italien sein Image als Weichwährungsland schon lange nicht mehr verdient, möchte ich darauf hinweisen, dass eine schwache Währung durchaus einhergehen kann mit einem starken Anstieg der Produktivität, die These von Nienhaus daher nur in einzelnen Fällen stimmt, also falsch ist.
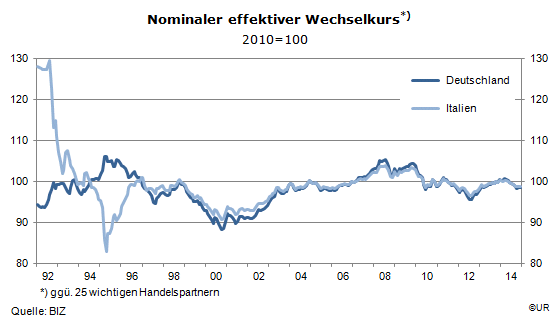
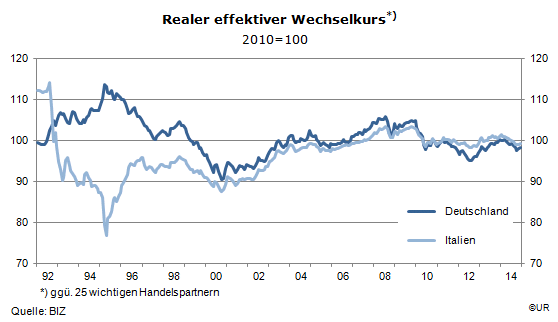
Aus der zweiten Grafik lässt sich ablesen, dass die Lira und der „italienische“ Euro seit 1996 real etwas fester waren als die D-Mark und der „deutsche“ Euro. Ich denke, der reale handelsgewogene Wechselkurs ist das beste Maß, wenn eine Aussage darüber getroffen werden soll, ob wir es mit einer Weichwährung oder Hartwährung zu tun haben. Deutschland besaß danach in den vergangenen zwei Jahrzehnten eher eine weichere Währung als Italien. Und was geschah bei der Produktivität? Wenn die folgende Grafik etwas suggeriert, dann das: Eine „Weichwährung“ hat positive Effekte auf die Wachstumsrate der Produktivität. Deutschland schneidet viel besser ab als Italien.
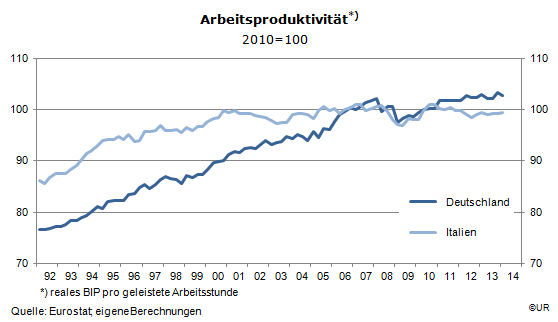
Nienhaus räumt im Übrigen an anderer Stelle in ihrem Artikel ein, dass Deutschland seinen wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Krieg, also sein Produktivitätswunder, nicht zuletzt einer unterbewerteten Währung zu verdanken hatte. Die „Weichwährung“ war das richtige Medikament zur richtigen Zeit.
Insgesamt gibt der Wechselkurs als Determinante der Produktivität nicht viel her. Investitionen in Sachkapital und Humankapital dürften der entscheidende Faktor sein. Kräftige Zuwachsraten sind aber auch dann zu erwarten, wenn eine robuste Endnachfrage auf unterausgelastete Kapazitäten trifft, so wie es in Deutschland in den fünfziger und sechziger Jahren und vielleicht auch heute wieder der Fall ist. Der Nachfrageschub könnte diesmal durch den Einbruch der Rohstoffpreise und der Einfuhrpreise allgemein ausgelöst werden, zusammen mit der günstigen Lage am Arbeitsmarkt und dem Nachholbedarf bei den öffentlichen und privaten Investitionen.
Mit anderen Worten: Freuen wir uns über den „weichen“ Euro. Was seine Kaufkraft angeht, ist er im Übrigen trotz der Abwertung gegenüber Dollar, Pfund und Schweizer Franken gar nicht richtig weich. Gemessen an den Außenhandelspreisen und den Verbraucherpreisen ist er vielmehr sowohl extern als auch intern sehr fest.