Am Markt steht es noch fifty / fifty, dass die Fed Funds Rate, der Leitzins der US Notenbank, am 17. September von 0,25 auf 0,5 Prozent angehoben wird. Dagegen glauben die meisten amerikanischen Ökonomen an eine Zinserhöhung (laut Bloomberg 77 Prozent). Es wäre die erste seit neun Jahren. Da die Fed die mögliche Reaktion der Märkte immer fest im Blick hat und Schocks vermeiden möchte, wird sie auch diesmal sorgfältig abwägen, was die Folgen wären. Ich vermute, dass ihr die Risiken im Augenblick noch zu hoch sind und sie bis zum Dezember oder darüber hinaus warten wird, je nach Datenlage.
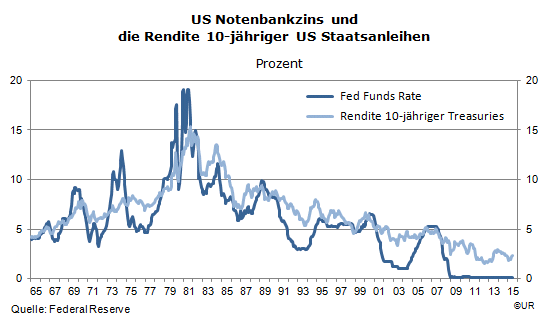
Was spricht für den Septembertermin? Vor allem das robuste Wachstum der US-Wirtschaft. Zwar war das reale Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal saisonbereinigt und auf’s Jahr hochgerechnet „nur“ um 2,3 Prozent gestiegen, nach 0,6 Prozent im ersten, es ist aber wahrscheinlich, dass das Ergebnis bei der nächsten Revision deutlich nach oben korrigiert wird, vermutlich auf knapp drei Prozent. Nach den Frühindikatoren dürfte für das jetzige, das dritte Quartal mindestens 2,5 Prozent herauskommen. Die Produktionslücke, die im Verlauf der Rezession 2008/2009 entstanden war, schließt sich allmählich.
Dass die Konjunktur gut läuft, zeigt sich zudem an den Zuwachsraten der Beschäftigung, die seit mehreren Jahren bei zwei Prozent liegen, sowie an dem rasanten Rückgang der Arbeitslosenquote auf zuletzt nur noch 5,3 Prozent. Die USA nähern sich der Vollbeschäftigung, wenn man einmal davon absieht, dass sich die sogenannte Erwerbsquote immer noch nicht erholt hat – viele Leute, die gern arbeiten würden, haben die Suche nach einem Job aufgegeben. Es sieht am Arbeitsmarkt nicht so richtig rosig aus, aber die Fed hat vor allem die Arbeitslosenquote im Fokus. Ursprünglich war signalisiert worden, dass ab einer Quote von 6,5 Prozent mit Zinserhöhungen gerechnet werden müsse. Diese Marke ist schon längst passiert.
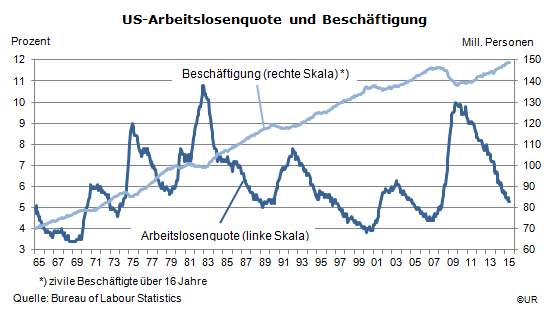
Höhere Zinsen sind auch aus anderen Gründen wünschenswert. Leitzinsen von Null, kombiniert mit QE (quantitative easing) und der sogenannten „Operation Twist“ – Maßnahmen, mit denen die längerfristigen Zinsen reduziert werden sollten –, verzerren die Allokation und die Preise von Krediten und Wertpapieren. Mit anderen Worten, es kann durch eine solche Geldpolitik zu Aktien- oder Immobilienblasen kommen, während gleichzeitig an den Gütermärkten Deflation herrscht. Das unvermeidliche Platzen von Blasen und das folgende „Deleveraging„, also der forcierte Schuldenabbau, bereiten Notenbanken oft unlösbare Probleme. Daher muss möglichst verhindert werden, dass Blasen überhaupt entstehen. Real sollte sich die Fed Funds Rate nicht zu weit und vor allem nicht zu lange von ihren fundamentalen Grundlagen entfernen. Außerdem braucht die Notenbank zinspolitischen Spielraum für den Fall, dass es demnächst wieder einmal eine Rezession gibt. Nach sechs Jahren Aufschwung rückt der Zeitpunkt immer näher. Nur wenn die Zinsen höher sind als Null lassen sie sich senken.
Insgesamt sind das überzeugende Argumente für eine baldige Zinswende. Es gibt allerdings einige gewichtige Gegenargumente.
Vor allem gibt es zurzeit keinen Grund, Inflation durch eine restriktivere Geldpolitik zu bekämpfen. Es gibt nicht nur keine Inflation, steigende Zinsen würden sogar die Deflationsrisiken erhöhen. Während sie die robuste inländische Nachfrage kaum beeinträchtigen werden – weil nur mit einem langsamen Anstieg zu rechnen ist, wenn überhaupt –, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der reale Wechselkurs des Dollar weiter festigen wird. Der Greenback ist aber schon jetzt sehr teuer.
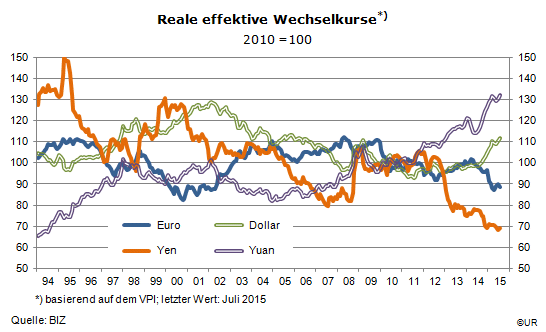
In den Einfuhrpreisen schlägt sich das am sichtbarsten nieder – sie lagen zuletzt um nicht weniger als 10,4 Prozent unter ihrem Vorjahreswert. US-Unternehmen, die mit Ausländern konkurrieren, haben es wegen des starken Dollar zunehmend schwer. Er zwingt sie, ihre Preise zu senken. Im Juli betrug die Inflation der industriellen Erzeugerpreise im Vorjahresvergleich minus 2,6 Prozent. In den kommenden Monaten ist mit noch niedrigeren Zahlen zu rechnen. Schon jetzt importieren die USA Deflation. Oft wird eingewendet, dass der Außensektor des Landes im Vergleich zu Euroland oder Japan ziemlich klein ist und die Außenhandelspreise daher keine Rolle spielen. Das stimmt aber nicht mehr. Die Summe aus Exporten und Importen von Gütern und Dienstleistungen beläuft sich mittlerweile auf etwa 30 Prozent des nominalen BIP.
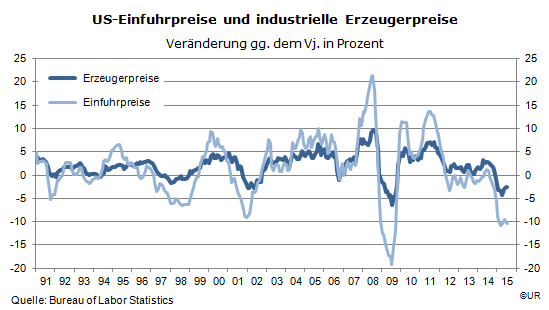
Ich bin angesichts dieser Zahlen ein bisschen verblüfft darüber, dass die Verbraucherpreise weiterhin leicht steigen. Eine Erklärung könnte sein, dass die reale Kaufkraft der Haushalte vor allem durch die sinkenden Energiepreise so kräftig zugenommen hat, dass sich die Nachfrage nach anderen Gütern und Dienstleistungen ebenso kräftig erhöht hat – was es den Anbietern ermöglicht, ihre Preise anzuheben. Im Juli lagen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent über ihrem Vorjahreswert, bereinigt um die Komponenten Nahrungsmittel und Energie allerdings bereits um 1,8 Prozent darüber, also nahe am Zielwert.
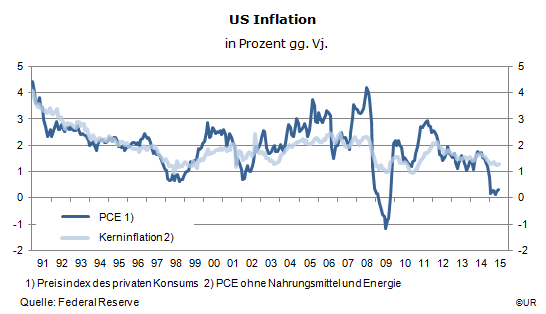
Die Fed wird sich vermutlich an die Kerninflationsrate halten, und zwar an den bereinigten Deflator der privaten Verbrauchsausgaben (PCE), der für sie die zugrundeliegende Inflationsdynamik am besten widerspiegelt. Er bewegt sich seit einiger Zeit im Vorjahresvergleich bei 1,3 Prozent und ist damit um Einiges zu niedrig. Von daher gibt es keinen Grund für höhere Zinsen. Ich rechne damit, dass sich der starke Rückgang der Einfuhrpreise bald auch in den Kernraten der Verbraucherpreise bemerkbar macht, so dass die 1,3 Prozent so etwas wie ein Deckel sein dürften.
Erfahrungsgemäß sind die Löhne als wichtigste Kostenkomponente entscheidend für die allgemeine Inflation. Da der Arbeitsmarkt brummt, sollte man eigentlich erwarten, dass die Löhne kräftig steigen. Tun sie aber nicht. Der Vorjahresabstand hat sich zuletzt erneut auf unter zwei Prozent vermindert, ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeitnehmer in keiner starken Verhandlungsposition befinden. Der Fed gefällt das gar nicht.
Bei genauerem Hinsehen geht von den Löhnen allerdings doch ein beträchtlicher Inflationsimpuls aus. Real, nach Abzug der aktuellen Inflationsrate von 0,1 Prozent, steigen sie um 1,7 Prozent. Da die Beschäftigung mit einer Rate von zwei Prozent expandiert, dürfte die reale Lohnsumme um fast vier Prozent höher sein als vor einem Jahr. Dem Teil der Bevölkerung, der einen Job hat, geht es finanziell ganz gut. Das Volumen des privaten Verbrauchs expandiert daher seit einem Jahr mit einer Rate von rund drei Prozent, einem Wert, von dem man in Euroland nur träumen kann.
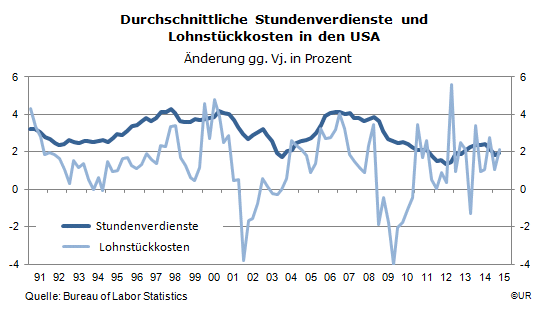
Auch an den sogenannten Lohnstückkosten lässt sich ablesen, dass die Löhne durchaus die amerikanische Inflation antreiben. Sie stiegen nämlich in den vergangenen vier Quartalen mit einer Rate von 2,15 Prozent und damit deutlich rascher als die Verbraucherpreise. Bislang ist die moderate Lohninflation nicht durch ein ähnlich hohes Produktivitätswachstums kompensiert worden. Insgesamt wird im Inland von der Lohnseite her Inflation generiert, nicht viel, aber immerhin – und der Ausgleich kommt über den Wechselkurs und sinkende Weltmarktpreise zustande.
Die Fed macht sich Sorgen, dass es an den Märkten für Aktien und Bonds nach der Zinswende zu einer Panik kommen könnte. Für Aktien gilt das mehr als für Bonds, weil sie nach den üblichen Bewertungsmethoden ziemlich teuer sind, bei recht bescheidenen Gewinnaussichten. Ein Crash kann nicht ausgeschlossen werden. Sollte der einen neuen Deleveraging-Prozess auslösen, könnte es zu konjunkturellen Problemen kommen. Die dürften sich aber im Rahmen halten, weil es diesmal ja nicht gleichzeitig eine Blase an den US-Immobilienmärkten gibt.
Die Kurse von Anleihen werden vermutlich deswegen nur wenig unter Druck geraten, weil die realen Renditen bereits sehr hoch sind. Nominal bringen etwa zehnjährige Treasuries heute 2,2 Prozent, während die aktuelle Inflation, wie erwähnt, bei nur 0,1 Prozent liegt. In Deutschland ist das Verhältnis übrigens aus Anlegersicht deutlich ungünstiger: 0,64 Prozent und 0,2 Prozent. Bei steigendem Zinsniveau sind Bonds außerdem dadurch etwas geschützt, dass die Kuponzahlungen zu höheren Sätzen wiederangelegt werden können – das verlangsamt ihren Kursverfall, wenn die Leitzinsen steigen.
Dabei haben die Marktteilnehmer Zeit gehabt, sich auf eine Zinswende vorzubereiten. Sie wird kommen. Dass die Renditen von Mitte Juli bis heute von 2,46 auf 2,2 Prozent gesunken sind, zeigt aber, dass die Anleger keine Angst vor der Fed haben. Die Notenbank braucht sich um sie keine Sorgen zu machen und muss sich nicht von ihnen bremsen lassen.
Weswegen sie am Ende den Zinsschritt doch hinausschieben dürfte, hat vor allem mit China zu tun. Dort scheint sich das Wirtschaftswachstum stärker abzuschwächen als gedacht. Die überraschende Abwertung des Yuan von 6,21 je Dollar auf 6,40 ist ein deutliches Indiz dafür. Das Land hat sich in den vergangenen Monaten immer mehr als Nachfrager von den Rohstoffmärkten zurückgezogen, wodurch die Preise von Erdöl, Gas, Kohle, Eisenerz und fast allen anderen Rohstoffen inzwischen im freien Fall sind. Für die USA bedeutet das weiter rückläufige Einfuhrpreise, was sich über Kurz oder Lang in erneut sinkenden Verbraucherpreisen bemerkbar machen wird – das Deflationsrisiko nimmt wieder zu.
Die Fed kann kein Interesse an einem noch festeren Dollar haben – weil sie keine De-Industrialisierung der amerikanischen Wirtschaft will. Es geht nicht an, dass die ganze Welt gegenüber dem Dollar abwertet. Sie muss also abwägen, was mit dem Dollar geschieht, wenn sie die Leitzinsen erhöht. Unter anderem dürfte ihr klar sein, dass die Unternehmen in den Schwellenländer zunehmend Probleme haben, ihre Dollarschulden zu bedienen. Vor allem in Lateinamerika droht eine neue Finanzkrise.
Mit anderen Worten, weil sich die Weltwirtschaft in einer prekären Situation befindet, zögert die Fed, das zu tun, was aus inländischer Sicht vielleicht angebracht wäre. Sie wird abwarten wollen, wie es von hier an international weitergeht.