Über die Feiertage habe ich endlich mal ein Buch gelesen, das schon lange auf meiner Liste stand: Joe Studwells „How Asia Works“ aus dem Jahr 2013. Es ist ein Plädoyer für Protektionismus in der Frühphase eines Entwicklungsprozesses.
Wenn ein armes Land rasch und nachhaltig wachsen will, sollte es sich an ein einfaches, aber in der Vergangenheit sehr erfolgreiches Rezept mit nur drei Zutaten halten: 1. Landreform – kleine Familienbetriebe statt Großgrundbesitz, weil dies in der Landwirtschaft ein Produktivitätsschub auslöst, wodurch der Output kräftig zunimmt und Arbeitskräfte für einen Einsatz in anderen Sektoren freigesetzt werden, gefolgt von 2. einer exportgetriebenen Industrialisierung mit massiven und gezielten staatlichen Eingriffen sowie 3. einer länger anhaltenden Finanzrepression, gekennzeichnet durch niedrige Zinsen für Schuldner aus der Industrie sowie Kapitalverkehrskontrollen, damit die Sparer nicht ihr Geld ins Ausland bringen – was darauf hinausläuft, dass sie durch niedrige und real oft negative Zinsen von den Banken zugunsten der Exportwirtschaft „enteignet“ werden, jedenfalls in der Frühphase, solange der Aufholprozess noch im Gange ist.
China hat sich an dieses Rezept gehalten, Russland dagegen nicht. Seit 1978, den Reformen Deng Xiaopings, hat das reale Bruttosozialprodukt Chinas im Durchschnitt jährlich um fast 10 Prozent zugenommen. In Russland begannen die Reformen erst nach dem Ende des Kommunismus im Jahr 1991 – in den 24 Jahren seit 1993 hat sich der Output unter starken Schwankungen preisbereinigt um jährlich nur rund 1,5 Prozent erhöht.
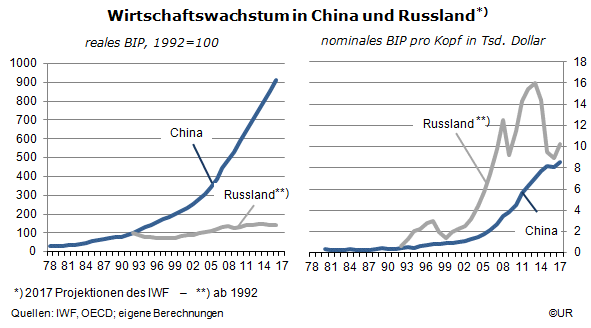
Die Moskauer Führung hatte auf ein anderes Rezept als China gesetzt, nämlich den sogenannten Washington Consensus mit den Elementen „Inflationsbekämpfung, Privatisierung und Liberalisierung“, nach dem Motto „Wettbewerb um jeden Preis, möglichst wenig Staat!“ Die Folge war, dass die russische Industrie, ähnlich wie die der ex-DDR, mit wenigen Ausnahmen fast über Nacht ausradiert wurde – sie war den ausländischen Konkurrenten nicht gewachsen als sich die Grenzen öffneten. Wie zu Zarenzeiten verlässt sich das Land immer noch auf den Export seiner Rohstoffe und tauscht diese gegen ausländische Industrieerzeugnisse. Und bleibt arm! Vor allem die erste der beiden obigen Grafiken zeigt, wie unterschiedlich sich die beiden Volkswirtschaften entwickelt haben.
Anders als wir das vielleicht in unserem kollektiven Gedächtnis haben, hatten Länder wie das Vereinigte Königreich, die USA, Frankreich und Deutschland in den ersten Jahrzehnten ihrer Industrialisierung nichts mit Freihandel am Hut. Dass sie heute für weltweit offene Märkte sind (Frankreich zwar nur mit Abstrichen), hat nicht viel zu bedeuten – sie sind ja bereits wohlhabend und haben gut reden. Für sie wäre Protektionismus ein Verlustgeschäft.
Studwell zeigt im Detail, auf welche Art diese Länder früher ihre jungen Industrien (infant industries) vor unliebsamer Konkurrenz schützten. Die berühmtesten Verfechter des Protektionismus in der Frühphase des kapitalistischen Prozesses waren Alexander Hamilton (1755-1804), einer der Gründungsväter der USA und ihr erster Finanzminister, sowie Friedrich List (1789-1846), der nicht nur entscheidend das deutsche (und amerikanische!) Eisenbahnnetz mit aufgebaut, sondern sich auch sein Leben lang für „Erziehungszölle“ eingesetzt hatte. Beide waren für Freihandel, aber eben nicht schon zu Anfang. In der Lernphase sei es legitim, sagt Studwell, die Erfolgsrezepte der Länder zu kopieren, die weiter entwickelt sind, einschließlich dem Abwerben tüchtiger Ingenieure und dem Stehlen von Patenten. Nicht zuletzt Preußen hatte es seit dem Alten Fritz darin zur Meisterschaft gebracht. Ganz zu Anfang war England das große Vorbild.
Später, ab der Meiji-Reform von 1868, übernahm Japan die nordamerikanischen und deutschen Erfolgsrezepte und lehrte die Welt bis Ende der 1980er Jahre das Fürchten. Bis zum Aktiencrash von 1989 und dem einige Jahre später folgenden Immobiliencrash glaubten manche Ökonomen, dass das japanische Sozialprodukt über kurz oder lang größer sein würde als das der USA. Auch in Japan wird aber nur, wie sich herausstellte, mit Wasser gekocht. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist das japanische pro-Kopf-BIP nach wie vor um Einiges kleiner als das amerikanische, und selbst niedriger als das deutsche. Vor allem gelang es nicht, die Rolle des Staates rechtzeitig zurückzudrängen und die Grenzen in beiden Richtungen zu öffnen.
Jüngeren Datums sind die rasanten Aufholprozesse Südkoreas und Taiwans. Für beide Länder war Japan das große Vorbild. Gemessen am BIP pro Kopf ist der Aufholprozess noch nicht abgeschlossen – es geht aber mit großen Schritten voran. Für Jahrzehnte dürften die Wachstumsraten hoch bleiben.
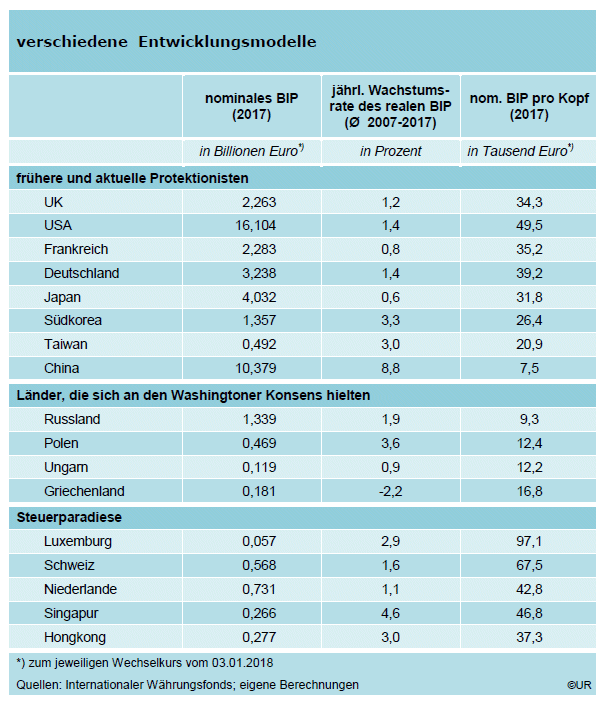
Und schließlich China: Berechnet mit sogenannten Kaufkraftparitäten ist das Land laut Internationalem Währungsfonds bereits größer als die USA, aber auch auf der Basis tatsächlicher Wechselkurse wird es nur noch zehn Jahre dauern bis die Amerikaner eingeholt sind (Annahmen: das nominale BIP der USA nimmt um vier Prozent pro Jahr zu, das von China um neun Prozent). Dass die Dynamik danach stark nachlassen sollte, ist, wenn man sich die Wachstumsprozesse in Japan, Südkorea und Taiwan ansieht, nicht zu vermuten.
Zusammenfassend kommt Studwell (auf S. 64) zu dem Schluss, dass es kein Land mit Freihandel an die Spitze der Weltwirtschaft gebracht hat. „In reichen Ländern wachsen wir in dem Glauben auf, dass aller Wohlstand durch Wettbewerb zustande gekommen ist. Die schockierende Wahrheit ist jedoch, dass sich jede wirtschaftlich erfolgreiche Gesellschaft in ihrer formativen Phase des Protektionismus‘ schuldig gemacht hat.“
In der Kritik an dem Buch wird stets darauf verwiesen, dass manche Länder mit ganz anderen Strategien ebenfalls erfolgreich waren – und sind. Das sind allesamt Länder, die ich in der Tabelle der Kategorie „Steuerparadiese“ zugeordnet habe. Für Studwell handelt es sich bei diesen nicht um autonome Volkswirtschaften – sie führen auf dem Rücken der Industrieländer gewissermaßen ein parasitäres Leben. Sie können daher für unterentwickelte Länder, die rasch expandieren möchten, nur sehr begrenzt als Vorbilder dienen. Jeder möchte gern in einer Bank, in einer Unternehmensberatung oder einer internationalen Anwaltssozietät arbeiten – das Umfeld ist angenehm, die Gehälter sind erstaunlich hoch –, aber ohne ein dynamisches Verarbeitendes Gewerbe, auf das sie sich beziehen, werden diese Dienstleistungen nicht benötigt.
Ein beunruhigender Aspekt von Studwells Thesen betrifft die EU. Er thematisiert das nicht, aber wenn an seinen Thesen etwas dran sein sollte, war der EU-Beitritt von Ländern wie Polen, Griechenland, Ungarn, Rumänien und Bulgarien für diese ein Schock, weil er einherging mit der fast sofortigen Freizügigkeit, mit Freihandel und freiem Kapitalverkehr. Es gab bei ihnen keine oder fast keine Unternehmen, die sich im internationalen Wettbewerb behaupten konnten. Sie wurden ins Wasser geworfen, bevor sie schwimmen gelernt hatten. Es fehlte die Phase des Protektionismus und der staatlichen Industriepolitik. Junge Firmen hatten keine Chance, groß und stark zu werden. Natürlich war es angenehm, auf einmal regelmäßig große Überweisungen aus Brüssel zu bekommen, aber das ändert nichts daran, dass sie vermutlich auf Jahrzehnte hinaus am schlecht bezahlten Ende der europäischen Wertschöpfungskette hängen bleiben werden. Das erklärt sicher auch die Ressentiments gegenüber den reichen Nachbarn im Westen. Ist unseren Politikern das eigentlich klar?